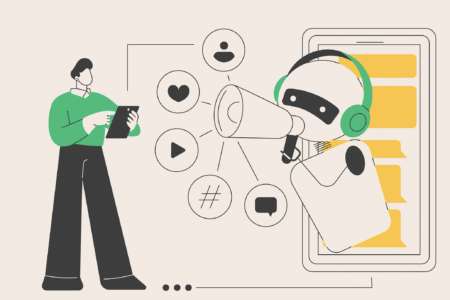ADHS trendet schon seit einiger Zeit in den sozialen Medien als Hashtag rundum Wohlbefinden und psychische Gesundheit. Gerade in der Pandemie und der Zeit danach haben viele junge Menschen unter dem Umgang mit der Ausnahmesituation und dem fehlenden Bewusstsein für Gesundheitsfragen gelitten. In den sozialen Medien finden sich daher besonders viele Postings rund um psychische Gesundheit. Und da ist alles dabei. Betroffene, die wirklich helfen wollen, Aufmerksamkeitssuchende, Verhaltensauffällige und Menschen, die reinen Herzens nach Kontakt, Vernetzung und tatsächlicher Hilfe suchen. Doch was passiert, wenn Krankheitsbilder inflationär für Wohlbefinden eingesetzt werden? Und was bedeutet das für tatsächlich Betroffene von Erkrankungen wie ADHS auf lange Sicht?
Was ist Normalität: Verständnis von der Norm wird immer enger ausgelegt
Wenn man das gesamte Phänomen betrachtet, wird es einem nicht gelingen, es sachlich zu bewerten. Den Fakt ist, nicht alle Postings sind gleich. Zahlreiche Postings verarbeiten wahrlich medizinisches Fachwissen rund um ADHS. Das kann für Betroffene eine Unterstützung bieten. Aber ebenso häufig findet man Bullshit dazwischen.
Eine schnelle Bewertung wäre an der Stelle zwar spannender, jedoch, wie es so oft im Leben ist, nur der komplizierte Weg ist der Richtige. Das Geheimnis dabei ist eine differenzierte Herangehensweise. Man kann nicht allgemein behaupten, dass das Trenden von Hashtags wie ADHS per se negativ ist. Eine mühsame Herangehensweise ist hier leider notwendig. Dabei muss man sich die einzelnen Akteur*innen so wie ihre einzelnen Postings anschauen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Eines lässt sich jedoch rund um die Causa ADHS im gesamten sagen: Es ist verdammt gefährlich, wenn in einer gnadenlosen Leistungsgesellschaft wie unserer die Norm, also alles, was wir noch als normal erachten, immer enger wird. Wenn jede Auffälligkeit bereits zur Krankheit hochstilisiert wird, kann sich das in der Anfangszeit psychisch wohlig warm anfühlen. Da tatsächlich Betroffene und Personen, die denken, sie wären betroffen, sich wahrgenommen fühlen.
Das kann zwar zu einem besseren Verständnis für gewisse Krankheitsbilder wie ADHS sorgen. Dadurch steigt das öffentliche Interesse auch mehr, was schlussendlich in mehr Gelder für die Erforschung der Krankheit münden. Doch auf lange Sicht können daraus für Betroffene und Menschen, die sich als solche geoutet haben, negative Folgen entstehen. Denn private Unternehmen und Plattform verfügen über ihre Informationen und Daten, sowie erstellten Inhalte. Und die sind nicht dem Allgemeinwohl verpflichtet, auch wenn sie das stets in ihrer Werbung beteuern. Was ist also, wenn politische Veränderungen dazu führen, dass diese Daten und dieser Input für völlig andere Zwecke instrumentalisiert werden?
Entweder voll konzentriert oder krank
Sollte wahre Diversität und psychologische Einfühlsamkeit nicht eher darin bestehen zu begreifen, dass wir uns als Menschen individuell unterscheiden? Und so eben auch unsere Aufmerksamkeitsspannen? Alles, was nicht ins Bild passt, gleich mit medizinischen Diagnosen wie ADHS einzudecken, kann kontraproduktiv sein.
Vielleicht ist es ja das System der Lohnarbeit, worauf unsere komplette Gesellschaft ausgerichtet ist, im Arsch und nicht du und deine Aufmerksamkeitsspanne. Dabei dreht sich schlussendlich alles um Fragen wie: Was ist Normalität? Braucht man bereits eine Diagnose, wenn man nur ein bisschen unkonzentriert ist?
Solche Trends von Hashtags wie ADHS können im Endeffekt dazu beitragen, dass der Leistungsdruck schlussendlich noch weiter steigt. Denn das, was dabei hängen bleibt, ist Folgendes: Jede Person, die sich nicht voll konzentrieren kann, ist krank. Also, anstatt dass wir uns die Verhältnisse anschauen, brechen wir alles auf den Charakter der Person und identifizieren ein Krankheitsbild. Etwas, was es in der Menschheitsgeschichte schon häufig gegeben hat und stets ein Warnzeichen für reaktionäre Zeiten war.
ADHS: Was sagt die Medizin?
Der Vorteil, den solche Trends mitbringen können, ist aber ebenfalls klar: Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist mittlerweile für viele kein Fremdwort mehr. Sie gehört zur Gruppe der Verhaltens- und emotionalen Störungen, die bereits in der Kindheit und Jugend auftreten können. Doch was genau verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung? Nun, ADHS äußert sich in Problemen mit der Aufmerksamkeit, Impulsivität und Selbstregulation. Manchmal gesellt sich auch noch eine ordentliche Portion körperliche Unruhe hinzu – Hyperaktivität nennen das dann die Fachleute.
Früher wurde ADHS als bloßes Verhaltensproblem abgestempelt. Doch heute wissen wir, dass es sich um eine komplexe Entwicklungsverzögerung des Selbstmanagement-Systems im Gehirn handelt. Es ist gewissermaßen wie eine musikalische Symphonie, bei der einige Instrumente nicht im Takt spielen. Und wir alle wissen, wie anstrengend Disharmonien sein können. ADHS kann man daher auch als Extremverhalten betrachten, das einen fließenden Übergang zur Normalität aufweist.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Um eine ADHS-Diagnose zu stellen, müssen die Auffälligkeiten wirklich stark ausgeprägt sein und seit der Kindheit in den meisten Situationen vorhanden sein. Hier sprechen wir von einem zwanghaften Verhalten, was man nicht kontrollieren kann. Und nicht nur Überdrehtsein oder halt keinen Bock haben, im Drecksjob 8 Stunden einen verblödeten Mist zu erledigen. Denn wir alle haben mal einen schlechten Tag. Symptome allein reichen jedoch nicht aus, um die Alarmglocken schrillen zu lassen.
Erst wenn sie das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen oder zu erkennbarem Leiden führen, sprechen die Mediziner*innen von einer gerechtfertigten ADHS-Diagnose. Außerdem ist ADHS fast immer eine Begleitdiagnose, das bedeutet, dass Betroffene meistens noch eine Palette weiterer psychischer Erkrankungen aufweisen können. Zusätzlich bewegen sie sich dann noch im ADHS-Spektrum.
Und was sagt die Statistik bei ADHS
Schauen wir uns doch mal die Zahlen genauer an. Weltweit sind etwa 5,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen von ADHS betroffen. In Deutschland sind es immerhin noch 4,4 Prozent ADHS gilt heute als die am meisten verbreitete psychiatrische Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen. So gesehen ist das Trenden von Hashtags wie #ADHS wiederum keine große Überraschung. Leider findet man bei uns in Österreich keine zuverlässigen Zahlen dazu, da sind unsere deutschen Nachbarn schon um einiges weiter. Übrigens werden Jungen häufiger mit ADHS diagnostiziert als Mädchen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Und was ist mit dem Verlauf von ADHS? Nun, Untersuchungen haben gezeigt, dass die Störung bei 40 Prozent bis 80 Prozent der diagnostizierten Kinder auch in der Adoleszenz fortbesteht. Im Erwachsenenalter ist bei mindestens einem Drittel der Fälle immer noch eine beeinträchtigende ADHS-Symptomatik vorhanden. Was natürlich wiederum für die zahlreichen Postings und Hashtags rund um ADHS spricht. Solange die Postings sachlich sind und keine Quacksalberei enthalten, sind sie auch für gewöhnlich kein Problem.
#ADHS: Wenn krank sein plötzlich trendet
Einen Trend im Nachhinein zu analysieren, ist ziemlich schwer. Die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, sind zu vielseitig. Was jedoch helfen kann, ist die Betrachtung der vorliegenden Verhältnisse. Fakt ist, heutzutage leiden junge Menschen immer stärker unter dem Leistungsdruck unserer Gesellschaft. Das drückt sich auf der einen Seite darin aus, dass sie tatsächlich immer häufiger psychisch krank werden, mit Diagnosen wie ADHS. Auf der anderen Seite finden sie in einer lauter und schriller werdenden Welt immer weniger Gelegenheiten, um sich Gehör zu verschaffen. Das kann man an Vorgängen beobachten wie die brutale Kriminalisierung von jungen Umweltschützern.
Daher müssen gerade junge Personen zu immer drastischeren Mitteln greifen, um überhaupt erst gesehen und gehört zu werden. Viele Menschen beginnen damit, sich selbst mit einer Krankheit wie ADHS zu diagnostizieren. Doch Vorsicht ist geboten, denn das kann auf lange Sicht auch gefährliche Konsequenzen haben.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Früher wurde über ADHS oft abwertend gesprochen. ADHSler galten als unerträgliche Nervensägen, die ständig nach Aufmerksamkeit gierten. So waren zumindest die allgemeinen Vorurteile und die grundsätzliche Haltung in der Bevölkerung. Mittlerweile ist aber vielen klar, dass sich die Krankheit in verschiedenen Formen äußert und dass Betroffene vor allem mit Aufmerksamkeitsproblemen zu kämpfen haben. Durch die vermehrte Diskussion in der Gesellschaft hat sich zwar die Stigmatisierung von AHDS verringert, doch es lauert eine andere Gefahr im Hintergrund. Der oft beschworene Backclash der häufig nach einem Trend kommt.
Die Gefahren der Selbstdiagnose
Auf TikTok gibt es dazu eine eigene Nische mit passendem Hashtag – das sogenannte „#adhstok“. Hier teilen Creator ihre angeblichen ADHS-Symptome und geben Tipps, nach denen sie nie gefragt wurden. Obwohl in den Videos oft wertvolle Anregungen zu finden sind, kann das dazu führen, dass Personen anfangen, Symptome an sich selbst zu erkennen. Die Auslöser können dabei minimal sein. Ein Spruch in der Schule, auf der Uni oder im Job. Oder dass Freunde sich aufgrund von Stress einfach keine Zeit nehmen wollen. Von Selbstzweifel zur Selbstdiagnose ist es dann meistens nicht mehr weit.
@clairebowmanofficial Replying to @itsame_april i hope these are helpful!!! 🖤 #adhdinwomen #adhdtips #adhdhelp #FreestyleFridays #adhdtok #adhdtiktok #adhdawareness #adhdadvocate #adhdproblems
Außerdem lässt sich der Wahrheitsgehalt in den Videos kaum nachweisen. Die Motive und der Antrieb der Personen hinter den „aufklärerischen“ Videos bleiben dabei oft im Verborgenen. Welche weitreichenden Folgen der gesamtgesellschaftliche Zugang zu Krankheitsbildern haben kann, ist historisch gut dokumentiert. Eine positiv anmutende Veränderung hat in der Leistungsgesellschaft aber leider meistens einen Haken.
Nicht alles ist gleich ADHS
Es besteht die Gefahr, dass der Leistungsdruck anstatt abzunehmen, durch solche Phänomene, eher zunimmt. Ein Zustand, dem man sich nur entziehen darf, wenn man krank ist. Dass das ganze System und die fehlende Work-Life-Balance dabei eine Rolle spielen, rutsch dadurch immer mehr in den Hintergrund.
Das größte Problem bei der Selbstdiagnose ist jedoch, dass viele der ADHS-Symptome im Alltag bei jeder Person gelegentlich auftreten können. Jede Person ist mal unaufmerksam, mal aufgedreht und hat auch mal Selbstzweifel. Bei ADHS geht es jedoch nicht nur um das Vorhandensein der Symptome, sondern auch um ihre Ausprägung und Dauer. Die Intensität macht erst die Krankheit, nicht die bloße Symptomatik.
Erst wenn man fast immer unaufmerksam ist, fast immer aufgedreht und fast immer starke Selbstzweifel hat, beeinträchtigt dies nachhaltig die Lebensqualität und wird zur Krankheit. Also einfach locker blieben und nicht gleich jedes Verhalten als Krankheit identifizieren. Vielleicht liegt es ja nicht an dir, sondern an der ganzen Scheiße um dich herum.
Titelbild © Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Pürstl, Nehammer, "liebe Polizei": Was wird das jetzt?
Die wohlbekannte Spitze des Eisbergs ist erreicht. Oder war diese sogar schon zuvor erreicht? Bereits mit dem Aufkeimen der Anti-Corona-Demonstrationen […]
"Die Anatomie eines Falls" mit Sandra Hüller
Ein tragischer Mord, eine Verdächtigte, ein einziger Zeuge. Ein fulminantes Drama, in dem Beziehungen zwischen Mutter, Sohn und Ehemann infrage […]
10 Tage kein Wort: Bühnenkünstlerin Denice Bourbon im Buddhistischen Zentrum
Wiens schillernde Bühnenkünstlerin Denice Bourbon erzählt über ihren Aufenthalt im Buddhismus Zentrum in Scheibbs und das Vipassana Seminar.
Corona-Demo in Salzburg: gilt dieser Aufruf als aktive Sterbehilfe?
Mit Bezugnahme auf das VfG-Urteil und bewusst provokant müssen wir wieder einmal berichten, dass Menschen fröhlich tanzend aneinandergereiht eine Demonstration […]
Julius Hügler: Revolutionär des Juweliergeschäfts im Gespräch
Wir haben den Wiener Traditionsjuwelier Julius Hügler zu einem Gespräch getroffen. Alles, was du über Bling-Bling-Welt wissen musst!
Elon Musk und seine Fails als neuer Twitter Chef
Schon mal im neuen Job Mist gebaut? Elon Musk geht es mit Twitter ähnlich. Hier eine gesammelte Liste seiner Twitter-Fails der ersten Wochen.