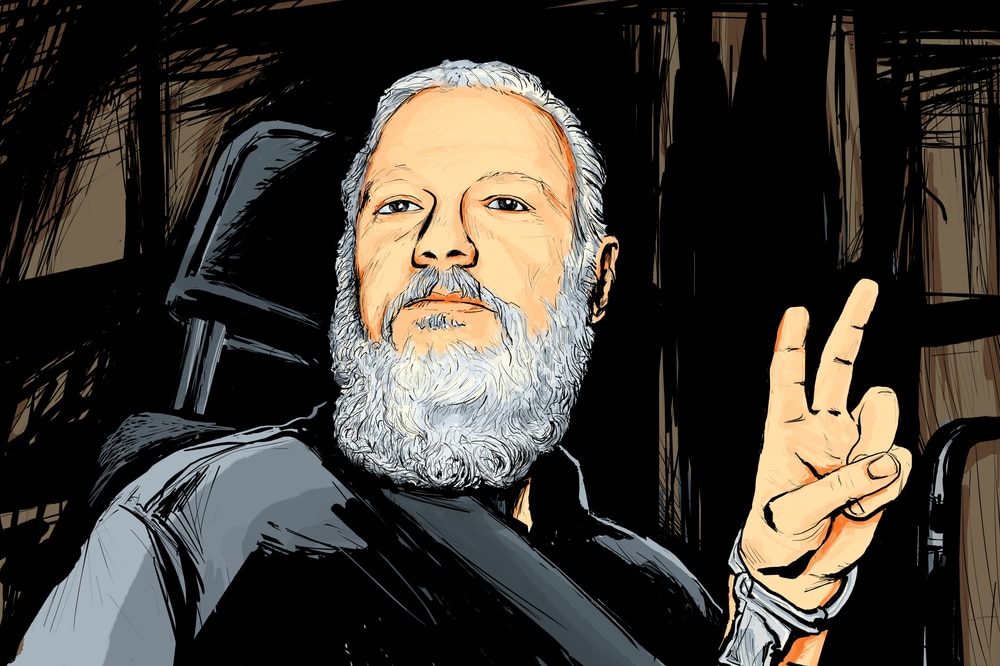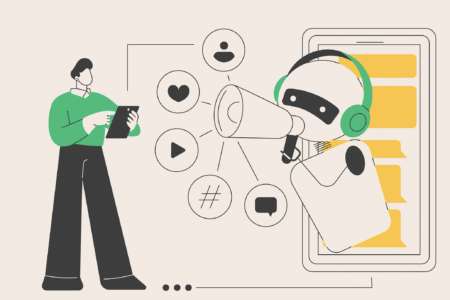Nach einer Ewigkeit der Stille im Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange und der Anklage gegen ihn geraten nun einige pikante Neuigkeiten ans Tageslicht, die überwiegend den bisherigen Verlauf der Ereignisse und Ergebnisse im Zusammenhang mit dem US-Justizministerium in ein anderes Licht rücken könnten. Ein Schlüsselzeuge gestand, dass er in der Anklageschrift wichtige Anschuldigungen erfunden habe.
Bei dem besagten Mann handelt es sich um Sigurdur Ingi Thordarson. Bei diesem kann man getrost oder höflich ausgedrückt von einer shady Person sprechen. Eine Historie von Soziopathie über mehrere Verurteilungen wegen sexuellem Missbrauchs von Minderjährigen bis hin zu weitreichendem Finanzbetrug zählen etwa zu seinen Errungenschaften.
Eine besonders perverse Dimension nimmt das ganze nur noch mehr dadurch an: Thordarson soll offenbar wie im Geständnis erwähnt all diese Taten parallel in Zeiten seiner Zusammenarbeit mit dem Justizministerium der USA verübt haben.
Von Anbeginn keiner Seite loyal
Es ist von einem Deal mit den Behörden auszugehen, wie man es aus Filmen kennt. Denn es ist davon die Rede, dass ihm Immunität vor Strafverfolgung garantiert wurde, wenn er zur weiteren Zusammenarbeit einwilligt. Weshalb diese Person denn überhaupt von solcher Relevanz für die Behörden ist, erklärt sich ganz leicht. Thordarson ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Assange und somit eine informative Quelle im Kampf gegen den Gründer der Investigativ-Plattform.
Daraufhin wird jener ehemalige Wegbegleiter – ob freiwillig oder durch Druck von Seiten der amerikanischen Justizbeamten – offenbar die Seiten gewechselt haben. Das interessante Detail in dieser Geschichte: Thordarson hat als freiwilliger Geldspenden-Sammler für Wikileaks mehr als 50.000 US-Dollar von der Organisation unterschlagen. Klingt doch nach einem vertrauenswürdigen und lupenreinen Kollegen. Doch wer einmal lügt, dem glaubt man (als FBI besser) nicht.
Ablenkungsmanöver und Unterstellungen als Vorwand für berechtigte Auslieferung
Wie gesagt, wie im Film. Wenn der Ganove plötzlich zum Cop wird und seine ehemaligen Brüder im Geiste verfolgt. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Dass die USA ein großes Interesse an der Auslieferung und Verurteilung des im Exil lebenden Politikaktivisten Assange hegen, sollte nicht weiter überraschen. Dass ihnen dafür jedoch solche Mittel recht sind, überrascht zwar auch nicht, doch bringt ein weiteres Mal ein gewisses Sittenbild zum Vorschein.
Und zwar eines, dass in einer öffentlichen Einrichtung eines modernen, freien Staates unvereinbar sein sollte, so heikel und prioritär die Leaks und Daten auch sein mögen. Doch der Zweck heiligt bekanntlich alle Mittel.
Nun wendet sich das Blatt jedoch unterwartet. Gerichtsdokumente, die davon handeln, dass Assange Thordarson angewiesen habe, Computereinbrüche, Gesprächsaufzeichnungen oder Hackerangriffe bei Abgeordneten in Island zu begehen, werden durch neuerliche Aussagen des 28-jährigen Isländers höchstpersönlich widerlegt.
In einem Interview räumt er ein, dass es niemals zu diesen Anweisungen oder gar Aktivitäten kam. Zwar habe es laut Geständnis eine Übermittlung durch einen unbekannten Dritten mit eben diesen vertraulichen und kriminell herangeschafften Daten gegeben. Jedoch wurden diese von ihm weder jemals ausgewertet, an Assange weitergegeben, noch gegen jemanden verwendet. Seine Behauptungen waren damals somit falsch.
Doch die Taktik der USA ging bereits auf. Von Seiten der im Verfahren zuständigen Richterin des Magistrats Court, Vanessa Baraitser, besteht eine wechselseitige Einstellung. Zum einen spricht sie sich gegen eine Auslieferung aus und begründet es mit dem gesundheitlichen Zustand sowie der voraussichtlich prekären Situation, die dem angeklagten Julian Assange in einem Gefängnis bevorstehen würde. Zum anderen schließt sie sich den Argumenten der amerikanischen Rechtsabteilung an, darunter auch mit der Berufung auf die konkreten Beispiele aus Island, die nun aber ausdrücklich in Frage gestellt werden müssen.
Die guten alten Chatprotokolle – ein Déjà-vu
Thordarson trifft nicht unvorbereitet auf die Journalisten. Mit einem selbst erstellten, gründlichen Untersuchungsbericht über seine Aktivitäten gewährt er Einblicke in noch nie zuvor veröffentlichte Chatprotokolle und neue Dokumente. Diese Kommunikation seiner Freiwilligenarbeit bei Wikileaks erstreckte sich über den Zeitraum 2010 bis 2011. Inhaltlich umfassen die Protokolle Mitarbeiter- und Hackergruppenchats.
An keiner Stelle erhärtet sich der Verdacht, dass Wikileaks Kenntnis von Thordarsons Kontakten mit Hackergruppen hatte, vielmehr belegen die Protokolle seine erfolgreichen Täuschungsabsichten. Höchstens die bloße Kenntnis über seine Aktivitäten war Assange bewusst, sodass es offenbar zu einer nonverbalen „Kommunikation“ der beiden kam, die sich Thordarsons jedoch bis heute nicht erklären kann.
Die Kommunikation ist inhaltlich durchzogen von einer prahlenden und beweihräuchernden Art und Weise, wie sich die selbsternannte Nr. 2 in der Organisation darstellt. Thordarson drängt die Hacker außerdem häufig dazu, entweder auf Material von isländischen Unternehmen zuzugreifen oder isländische Websites anzugreifen. Mit speziellen Cyber-Attacken sollten sie Websites deaktivieren und unzugänglich machen, ohne dabei den Inhalt dauerhaft zu beschädigen.
Eine Erklärung, weshalb es überhaupt im Interesse von Wikileaks oder Julian Assange stehen sollte, Interessen oder Behörden in Island anzugreifen, insbesondere in einer so sensiblen Zeit der medialen Ereignisse, blieb Thordarson schuldig. Es besteht kein Anhaltspunkt, dass Assange irgendwelche Beschwerden mit den isländischen Behörden hatte. Er arbeitete hingegen mit Parlamentsabgeordneten an einer Novelle des isländischen Pressefreiheitsgesetze für das 21. Jahrhundert.
USA-Behörden bewegen sich bewusst auf dünnem Eis
Scheinbar belastet den jungen Mann sein enorm schlechtes Gewissen oder es steckt etwas anderes hinter dem Geständnis. Seine in der Tat schurkischen Machenschaften, ob das Errichten von geheimen Kommunikationswegen mit Journalisten oder sämtliche von den Medien bezahlte Auslandsreisen sowie der persönliche Identitätsschwindel, ein offizieller Vertreter von WikiLeaks zu sein, oder der Datendiebstahl von MitarbeiterInnen gehören unter anderem zu seinem Repertoire.
In Unkenntnis darüber, dass das FBI aufgrund einer Aussage mittels Verhör durch einen Hackerkollegen längst auf Thordarson angesetzt war, setzte dieser munter seine Machenschaften fort. Nun sah das FBI, das von einer ehrlichen Zusammenarbeit Assanges mit Thordarson ausging, endlich die Gelegenheit, etwas gegen Wikileaks in der Hand zu haben und Assange zu beschuldigen.
Den Justizbehörden der USA ist vollkommen bewusst, wie groß zu dieser Zeit die Bedrohung einer Organisation bzw. eines Whistleblowers wie Assange ist, wenn diesem nicht bald ein Riegel vorgeschoben wird. Hierbei schreckte man nicht zurück, selber mit unredlichen, illegalen Mitteln (selbstverständlich „ausschließlich zum Schutz der Interessen des eigenen Landes“) zu arbeiten. Oder wohl eher zur Schadensbegrenzung.
Die Täuschung gelingt auf beiden Seiten
Es ist jedoch ein offenes Geheimnis, dass (amerikanische) Sicherheitsbehörden ihre Augen und Ohren überall haben und alles mitbekommen, wenn sie nur wollen. Sie waren den Umständen entsprechend sogar dreist offen im Umgang ihrer Aktivitäten. Denn selbst dem isländischen Innenministerium und daher auch der Polizei und Staatsanwaltschaft war bewusst, dass hier regelrecht ein Spinnennetz gesponnen wurde, um Assange zu fangen.
Dafür reisten FBI Mitarbeiter nach Island mit dem Vorwand, die dortigen Einrichtungen zu beobachten und zu schützen, da man mit einem ernsten Hackerangriff von außen rechne. Dies stellte sich als eine Lüge heraus und sollte auschließlich dem Hintergrund dienen, die Falle zuschnappen zu lassen. Die angeblichen Angriffe auf isländische Interessen blieben aus, das FBI würde jedoch künftig wiederkehren.
Im Zuge dieser Ermittlungen befand sich Thordarson mittlerweile auf dem Radar der Ermittler, nachdem dieser schließlich auch schon von Wikileaks verfolgt wurde. Um seine Sicherheit bemüht, trifft Thordarson eine außergewöhnliche Entscheidung im Moment der Not. Sein Ausweg lautet, zu verpfeifen und wer wäre in diesem Fall besser dafür geeignet als er selbst.
Darum schickte er am 23. August eine E-Mail an die US-Botschaft in Island. Er habe Informationen zu einer strafrechtlichen Untersuchung. Dadurch wurde er sogleich als Informant im Fall Julian Assange bestätigt. Man hatte es offenbar äußerst eilig. Bereits 48 Stunden später landete ein Privatjet in Reykjavik mit etwa acht Agenten.
Mit dem Starzeugen im Gepäck ging es dann schließlich auf Druck der isländischen Behörden aufgrund der unrechtmäßigen Ermittlungsmaßnahmen der US-Agenten nach Dänemark. Doch nach Monaten der Zusammenarbeit ließ das FBI den Maulwurf wieder gehen, da er offenbar nicht mehr von Interesse für sie war.
Zeitglich werden in Island zahlreiche Verbrechen Thordarsons publik gemacht. Darunter fallen massiver Betrug, Fälschungen, Diebstahl und sogar sexuelle Übergriffe gegen minderjährige Jungen, bei denen er die Opfer austrickste und zu sexuellen Handlungen zwang. Bei den darauffolgenden Gerichtsverhandlungen ließ der Richter Milde walten, da sich Thordarson in allen Anklagepunkten für schuldig bekannte. Ein psychiatrisches Gutachten diagnostizierte außerdem Soziopathie.
Hinterzimmerdeals – Quid pro Quo
Nachdem Thordarson wieder auf freiem Fuß war, änderte sich nicht allzu viel in seinem Verhalten und seiner Lebensweise. Er setze sein kriminelles Leben fort, jedoch brauchte er gleichzeitig Sicherheiten. Die Nachfolgeregierung unter Trump hatte nach wie vor großes Interesse an ihm, jedoch war er immer nur Mittel zum Zweck.
Abermals kam es zur Kontaktaufnahme und persönlichen Begegnung. Die Garantie auf Immunität vor jeder Strafverfolgung im Austausch gegen weitere Informationen waren Inhalt des Deals. Für die USA war Thordarson immer der Schlüssel zu Assange.
Bis zum heutigen Tag führt der auf freiem Fuß lebende Hobby-Gangster seine kriminellen Aktivitäten fort. Diese erstrecken sich über verschiedene Ebenen des Betrugs. Damit geht er übrigens auch recht offen und ehrlich um, da er alles als normale Geschäftspraxis bezeichnet. Eine neue Anklage gegen ihn gibt es bisher nicht.
Es ist davon auszugehen, dass wir nur die Spitze des Eisberges vorgelegt bekommen. Ob in dieser Causa oder etlichen weiteren der gleichen Natur. Das gesamte Ausmaß der Ereignisse, Entwicklungen und generellen Aktivitäten sowie des moralischen Verfalls für die eigene Gunst und Gier dürfte weiterhin reine Spekulation bleiben.
Die Zeit wird es weisen. Man kann jedenfalls gespannt bleiben und diese Sache getrost weiterverfolgen. Eines ist jedoch sicher, die brisanten Enthüllungen werden wohl kaum was an der misslichen Lage Assanges sowie dem Bestreben seitens der USA in dieser Causa verändern.
Zu guter Letzt dürfen wir euch an dieser Stelle eine Filmempfehlung geben. Snowden (2016) erzählt die Geschichte des jungen Mitarbeiters des amerikanischen Sicherheitsdienstes. Und wie diese Behörden illegales plötzlich legal werden lassen und ohne Autorität in privaten Haushalten spionieren. Der Film ist unter anderem auf Netflix abrufbar.
Titelbild Credits: Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
State of the Union: Eheprobleme, verpackt in geniale Mini-Serie
Rosamund Pike und Chris O’Dowd brillieren als herrlich verschrobenes Paar vor der Trennung in Stephen Frears Mini-Serie State of the Union.
Refund-Masche
Betrüger verdienen online viel Geld durch die Refund-Masche. Was hat das für Auswirkungen auf ehrliche Käufer*innen?
Druck von Handelsverband zeigte Wirkung: Ende der Maskenpflicht im Handel ab 1. Juni
Während die meisten wieder wie vor Corona-Zeiten ihren beruflichen Tätigkeiten nachgehen konnten, sah es für die Angestellten im „lebensnotwendigen“ Handel […]
Adopt, Don't Shop: ein Zeichen für Tieradoption
Tieradoption. Tierschutz Austria und die vegane Burgerkette Swing Kitchen rufen dazu auf, Haustiere zu adoptieren, anstatt sie zu kaufen.
White Lines: mit Koks durch Ibiza den Mord am Bruder lösen
Haus des Geldes-Erfinder Álex Pina inszeniert in der Netflix-Serie White Lines ein irrwitziges Cold-Case-Szenario.
Neuerlicher Versuch der Regierung, private Haushalte zu regeln
Deja Vu! Als hätte es nicht schon einmal seitens des Verfassungsgerichtshofes geheißen, dass Eingriffe in den privaten Raum unzulässig seien, […]