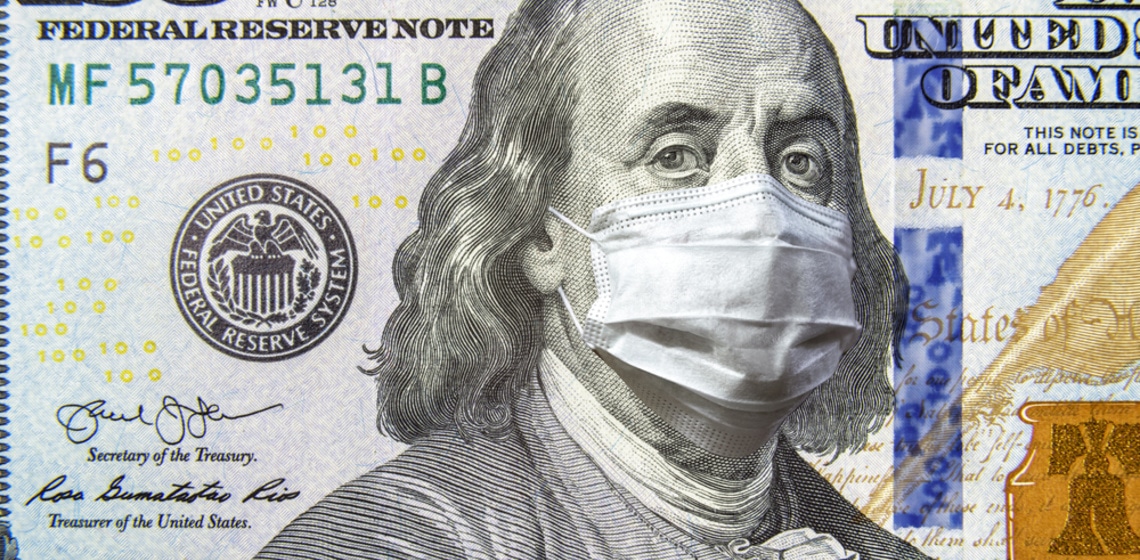Filme sind für Männer – Was bedeutet Male Gaze und wieso ist er überall?

Ich dachte lange, ich mag einfach keine Filme. Vor allem männliche Freunde fanden das komisch. „Wie kann man sich nicht für Film interessieren?“ Bis ich das erste Mal vom Male Gaze hörte. Und plötzlich ergab alles Sinn.
Was ist eigentlich der Male Gaze?
Der Male Gaze – also der männliche Blick – beschreibt, wie Filme (und Serien, und Werbung, und eigentlich alles Visuelle) unsere Welt ausschließlich durch männliche Augen erzählen.
Heißt: Frauen werden nicht gezeigt, wie sie sind, sondern wie Männer sie sehen wollen – sexy, gefällig, verfügbar. Sprich: Für Frauen sind viele Mainstream-Filme verstörend und unangenehm oder oft auch einfach nur furchtbar langweilig.
Warum ist das so? Weil bis heute die meisten Menschen hinter der Kamera – Produzenten, Regisseure, Drehbuchautoren – Männer sind.
Weiße, heterosexuelle Männer, um genau zu sein. Und wenn die bestimmen, was „filmreif“ ist, sieht das Ergebnis eben so aus, wie es aussieht: Männer sind Helden, Frauen sind sexy.
Dieser Blick, den Filmtheoretikerin Laura Mulvey 1975 in ihrem Werk Visuelle Lust und narratives Kino als Male Gaze bezeichnete, prägt Filme und Fernsehproduktionen bis heute.
Action, Sex und Waffen – und der immergleiche Held
Beispiele für den Male Gaze gibt’s unendlich viele:
Von James Bond über Fast & Furious bis Oppenheimer – überall dasselbe Spiel: Männer handeln, denken, kämpfen, retten. Frauen schmücken, lieben, unterstützen, verführen. Sogar im Arthouse – bei Filmen wie Her oder Ex Machina – wird der weibliche Körper zum Projektionsobjekt männlicher Sehnsüchte.
Der Male Gaze steckt in jedem Frame – und in jeder Lichtquelle
Der Male Gaze zeigt sich auch in der visuellen Gestaltung von Filmen. So etwa in Beleuchtung, Kameraperspektive, Kostüm- und Maskenbild. Männer werden oft kontrastreich ausgeleuchtet, wobei Falten sogar betont werden, um Charaktertiefe und Status zu unterstreichen.
Frauen hingegen werden weich und gleichmäßig beleuchtet, um sie jünger wirken zu lassen; ihr Alter wird eher als Verlust von Schönheit und Jugend denn als Gewinn an Erfahrung dargestellt.
Die Kamera zerlegt weibliche Körper außerdem häufig in einzelne Ausschnitte – etwa Nahaufnahmen von Beinen in High Heels oder von leicht bekleideten Körperpartien. So trainieren uns Filme, was als „schön“ gilt – und was als „wertvoll“.
Wenn Gewalt zum Stilmittel wird
Filme, die Gewalt oder Übergriffigkeit aus männlicher Sicht erzählen, sind keine Ausnahme – sie sind der Standard. Mulvey nennt es „sadistischen Voyeurismus“.
Die klassische Kuss-Szene, in der er sie gegen ihren Willen küsst, bis sie „doch will“.
Auch Vergewaltigungsszenen – wie in Larry Clarks berühmten Film-Klassiker aus den 90ern Kids – werden teilweise verharmlosend und aus männlicher Sicht dargestellt, sodass das Mitgefühl des Publikums eher dem Täter gilt, der in diesem Fall befürchten muss, sich bei der bewusstlosen, AIDS-positiven Frau anzustecken.
Teilweise kommen Vergewaltigungsszenen vor, obwohl sie für die Handlung gar nicht relevant sind. Solche Szenen zeigen nicht nur Gewalt, sie gewöhnen uns daran und normalisieren sie.
100 Jahre Filmgeschichte – und die Kamera gehört immer noch den Männern
Eine Analyse von 100 Jahren Filmgeschichte zeigt: Frauen waren in der Branche nie auch nur annähernd gleichberechtigt.
Bevor Hollywood in sein „Goldenes Zeitalter“ eintrat, gab es in der Filmbranche allerdings noch viele unabhängige Produzent*innen, was es vergleichsweise vielen Frauen erleichterte, Arbeit zu finden. Zwischen 1915 und 1920 jedoch setzte sich das sogenannte Studiosystem durch: Fünf große, von Männern geleitete Studios (Warner Bros., Paramount, MGM, Fox und RKO Pictures) übernahmen die Vorherrschaft. Diese einflussreiche Männerriege, unterstützt von Kapital aus der Wall Street, vergab Führungspositionen bevorzugt untereinander. Frauenrollen wurden zunehmend nach einem klar begrenzten, männlich geprägten Ideal gestaltet – aus der Perspektive eines heterosexuellen, bürgerlichen, weißen Blicks, der Frauen vor allem als sexualisierte Objekte männlichen Begehrens und Besitzanspruchs sah.
Frauen, die Geschichte schrieben – aber im Abspann fehlen
Selbst in historischen Stoffen bleiben Frauen nach wie vor oft unsichtbar. Ein aktuelles Beispiel: Oppenheimer (2023). Ohne Forscherinnen wie Lilli Hornig oder Maria Goeppert Mayer wäre das Manhattan-Projekt nie möglich gewesen – aber im Film? Kommen sie kaum vor.
So entsteht der Mythos vom einsamen männlichen Genie – und weibliche Leistungen verschwinden im Hintergrund.
Das nennt man Male Bias. Und der zieht sich durch Wissenschaft, Politik – und Hollywood gleichermaßen.
Der Bechdel-Wallace-Test für Filme
1986 machte ein Comic den Gender Gap im Kino richtig sichtbar: In Dykes to Watch Out For formulierte Alison Bechdel eine simple Regel, die später zum berühmten Bechdel-Wallace-Test wurde:
Es müssen mindestens zwei Frauen vorkommen, die miteinander sprechen – und zwar über etwas anderes als einen Mann.
Klingt einfach, oder? Die meisten Filme bestehen den Test trotzdem nicht. Der Bechdel-Wallace-Test – inspiriert von Virginia Woolf und benannt nach Bechdel & Liz Wallace – ist heute weit verbreitet. Er zeigt: Frauen existieren im Kino meist nur in Bezug auf Männer.
Langsam verändert sich etwas
Immer mehr Frauen schreiben, produzieren und führen Regie – und das sieht man.
Filme und Serien wie Fleabag, I May Destroy You, Showing Up oder Saint Omer erzählen nicht länger, wie Frauen aussehen sollen, sondern wie sie fühlen und denken. Sie brechen mit der Heldenerzählung, lassen Widersprüche zu und zeigen Weiblichkeit endlich vielschichtig.
Fazit: Es lag nicht an dir – es lag am Male Gaze
Wenn du also auch dachtest, du „magst einfach keine Filme“, dann stimmt das womöglich gar nicht.
Vielleicht mochtest du nur nicht die immer gleichen langweiligen Geschichten, die Männer zu Helden und dich zum Objekt machen. Zeit, den Blick zu wechseln – und Filme zu feiern, die nicht für Männer, sondern für Menschen gemacht sind.
Quelle: https://www.medienradar.de/hintergrundwissen/artikel/wie-der-male-gaze-in-die-filme-kam
Titelbild © Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Weltkrebstag: ein Tag für Aufklärung, Hoffnung und Solidarität
Angefangen hat es mit Kleinigkeiten. Als Gertrude zum Einkaufen ging, vergaß sie, den Herd abzudrehen. Dabei war ihr Gedächtnis immer […]
Kommentar der Woche: Rosi, Franzi und die Impfgegnerschaft
Die sozialen Medien strotzen nur so vor Meinungsbildung. Manchmal weniger fundiert, manchmal mehr. Gerade während der Corona-Krise nehmen die Symptome […]
Alle schauen nach rechts zur Coronakrise, während sich links wieder der Neoliberalismus austobt!
Es steht außer Frage, dass das Coronavirus die Welt in Atem hält und unser bisheriges Leben massiv auf den Kopf stellt. Ebenso, dass dieses Virus für den Tod vieler Menschen verantwortlich ist.
Doch ist die Frage, wer denn nun wirklich Schuld sei an dieser Krise - der wirtschaftlichen und der gesellschaftlichen –, mit Sicherheit nicht einfach mit dem Coronavirus zu beantworten. Deshalb stelle ich mich dieser Frage und versuche, den Problemen neue Perspektiven zu verleihen.
Streetart für die Ewigkeit: Plattform launcht ausgewählte Pieces als NFTs
Die Plattform WorldWideWalls – kurz WWWalls – erschließt neue Welten der Kunst und macht diese in Zusammenarbeit mit Calle Libre, […]
Blutbuch – Kim de l'Horizons fulminantes, non-binäres Romandebüt
Mit Kim de l'Horizons Debütroman Blutbuch (erschienen bei DuMont) ist seit langem und endlich, endlich, muss man sagen, nein, endlich, muss man schreien! ein Text erschienen, der literarisch geradezu meisterhaft ein Phänomen einzufangen vermag, mit dem sich viele Literaturschaffende schwertun.
White Lines: mit Koks durch Ibiza den Mord am Bruder lösen
Haus des Geldes-Erfinder Álex Pina inszeniert in der Netflix-Serie White Lines ein irrwitziges Cold-Case-Szenario.