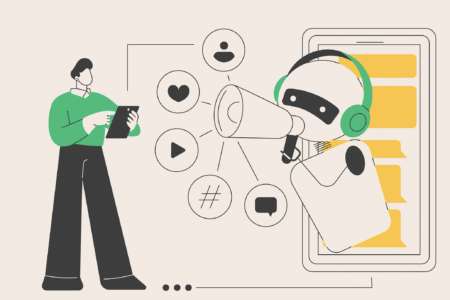Cultural Appropriation: Was die Verwendung von Symbolen anderer Kulturen vom kulturellen Rassismus unterscheidet

Das Konzept „Cultural Appropriation“ (zu Deutsch: „kulturelle Aneignung“) rückt derzeit wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Grund dafür ist u.a. die Absage von Fridays for Future Hannover an die Sängerin Ronja Maltzahn, die damit begründet wurde, dass die Sängerin Dreadlocks habe. Doch welche Probleme ergeben sich auf Basis dieser Perspektive und wodurch unterscheidet sich „Cultural Appropriation“ von kulturellem Rassismus?
Im Zentrum dieses gegenwärtigen Diskurses über Cultural Appropriation steht nicht die materielle Aneignung von Kulturgütern (wie dies im Zusammenhang mit Museen häufig diskutiert wird). Sondern die vermeintlich problematische Übernahme von äußeren Merkmalen, die einer bestimmten Gruppe von Menschen zugeordnet ist.
Die Gründe für diese Übernahme kultureller Symbole reichen vom individuellen ästhetischen Empfinden bis hin zu spezifisch subkultureller Stereotypisierung. Auf die politische Einstellung der Protagonist:innen kann allein aufgrund des Tragens der Symbole heute kaum noch geschlossen werden. Dennoch wird der Vorwurf gegen sie erhoben, sie würden sich rücksichtlos an anderen Kulturen bedienen.
Cultural Appropriation vs. Kultureller Rassismus
Das Argument, das hier im Raum steht, ist eines, das die Machtstrukturen in den Vordergrund rücken will. Und das zurecht: Die weltweite historische Ausbeutung durch den globalen Norden und der Mehrheitsgesellschaft in diesen Ländern hat Verhältnisse geschaffen, deren Resultat auch heute noch systemischer Rassismus ist, dessen Kennzeichen Diskriminierung oder ganz offen ausgetragene Gewalt sind.
Dieser Rassismus hat sehr wohl auch eine kulturelle Form. Diese soll keinesfalls unterschätzt oder hier unterschlagen werden. Es ist vermutlich keine Übertreibung zu behaupten, dass sich diskriminierende Zugangshürden in allen Bereichen der Kunstwelt finden lassen. Kultureller Rassismus hingegen lässt sich sehr gut an der Debatte um die Cleveland Indians verdeutlichen:
Die Lenni Lenape oder Delewaren waren einer der Stämme in Cleveland, Ohio | Flickr/Steven Zucker; CC BY-NC-SA 2.0
In einem Land, in dem Europäer Massenmorde an den Einheimischen begangen haben, hatten die Nachfahren dieser Invasoren 1915 die Idee, sich selbst den Namen zu geben, den ihre Vorfahren pauschal den dort bekämpften und versklavten Völker gaben. Nachdem dies immer wieder zu (gerechtfertigten) Diskussionen um den Namen des Teams führte, benannte es sich 2021 in „Cleveland Guardians“ um. Doch wie steht es um kulturelle Symboliken, um die es beim Konzept der Cultural Appropriation geht? Welche Idee steckt dahinter?
Cultural Appropriation als gefährliche Grenzziehung
Simpel und einfach heruntergebrochen geht es darum: Kulturelle Symboliken, die die Menschheit zu jeder Zeit bereits ausgetauscht hat, „gehören“ als Definitionsmerkmal einer – wenn überhaupt – nur schwammig bestimmbaren Gruppe von Menschen. Dadurch wird diese Gruppe jedoch als „die Anderen“ im Gegensatz zum „wir“ festgeschrieben. Genau die Art von gesellschaftlicher Grenzziehung kommt damit zur Reproduktion, die es im Sinne einer offenen Gesellschaft zu überwinden gilt. Es ist sehr bezeichnend, dass das Konzept „Cultural Appropriation“ oft gerade jene diskutieren, die der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören.
Wo liegen die Grenzen?
Das Set von kulturellen Symboliken in einer Gesellschaft ist im besten Fall fluid. Und hängt zudem von der Zusammensetzung derselben ab. Kein Set von kulturellen Symboliken existiert ohne Machtverhältnisse, in die diese eingebunden sind. Diese Machtverhältnisse lösen sich natürlich nicht automatisch dadurch auf, dass Symbole anderer Kulturkreise in eine Gesellschaft Einzug finden. Symbole sind nun mal symbolisch.
Es lässt sich selbstverständlich darüber streiten, welche Machtverhältnisse hinsichtlich der Cultural Appropriation mehr von Bedeutung sind als andere. Dabei wird jedoch nie ein für alle akzeptables und einheitliches Ergebnis herauskommen (was nicht heißt, dass es darüber keine Diskussion geben sollte).
Denkbar wäre auch, die Diskussion weg von der gewaltsamen Aneignung hin zur gemeinsamen Nutzung von kulturellen Symbolen zu lenken – ohne dabei jedoch den diskriminierenden status quo von Minderheiten zu ignorieren. Oder gar die rassistischen Gräuel der Vergangenheit und Gegenwart in Abrede zu stellen. Ein differenzierter Blick auf die mit dem Konzept gemeinten Gruppen würde der Diskussion sicherlich auch nicht schaden. Dadurch wäre in vielen Fällen feststellbar, dass sich die diskutierten Symbole oft nur schwer einer bestimmten Gruppe von Menschen zuordnen lassen.
Cultural Appropriation vs. kulturellen Austausch
Eine Ausnahme stellt mit Sicherheit das Maori-Tattoo am linken Oberarm von Klaus aus Wien-Döbling dar, womit er sich womöglich unter Maoris wenig beliebt macht (auch wenn diese mittlerweile ihre Symbole selbst an Tourist:innen verkaufen). Dass Gerry aus Innsbruck mit seinen blonden Dreadlocks auf Jamaika sehr wahrscheinlich sämtliche Klischees vom weißen Kolonisator erfüllt, ist verständlich.
Wenn es aber um die Gesellschaft geht, in der wir leben, dann stellt sich doch wirklich die Frage: Soll es eine sein, in der jeder Mensch nur an der Kultur, die der eigenen Herkunft entspricht, teilhaben kann? Ist denn das überhaupt wünschenswert? Wie sähe eine solche Gesellschaft überhaupt aus und welche Probleme ergäben sich dadurch möglicherweise?
Titelbild © Unsplash | Debashis RC Biswas
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Angestellte im Handel zum Tragen von FFP2-Masken verdammt: Petition soll Abhilfe schaffen
Während die meisten im Sommer ihren beruflichen Tätigkeiten unter normalen Umständen – heißt wie in Pre-Corona-Zeiten – nachgehen können, müssen […]
Adopt, Don't Shop: ein Zeichen für Tieradoption
Tieradoption. Tierschutz Austria und die vegane Burgerkette Swing Kitchen rufen dazu auf, Haustiere zu adoptieren, anstatt sie zu kaufen.
Murder Mystery 2: wie lustig sind Adam Sandler und Jennifer Aniston?
Werden Adam Sandler und Jennifer Aniston mit der Fortsetzung "Murder Mystery 2" an den Erfolg von Teil eins anschließen können?
Krankheiten erfinden, Grenzwerte verschieben: wie manipulativ ist die Pharmaindustrie?
Den Trick der Pharmaindustrie, Altes als Neu zu verkaufen, kennen wir bereits. Kein Weg ist ihr zu schäbig und moralisch […]
Separatorenfleisch: die dunkle Seite der Wurst
Nicht gekennzeichnetes Separatorenfleisch in deutschen Würsten gefunden. Alles, was du über die Weiterverwendung der Fleischreste wissen musst.
WIEN: Pride 2024 // cat calling, trash und demonstration
Dieser Artikel enthält einen PERSÖNLICHEN und SUBJEKTIVEN Bericht über die Pride Parade/Regenbogenparade 2024 in Wien.