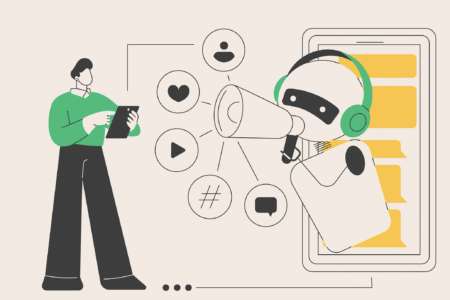Armut – etwas, das niemand gerne öffentlich eingesteht. Auch nicht, wenn die Betroffenen selbst gar keine oder nur wenig Schuld trifft. Stattdessen machen sich diverse TV-Formate lustig darüber und stigmatisieren jene, die unter Armut zu leiden haben – zum Teil auch die Politik. Zur Belustigung vieler und zum Leid vermeintlich weniger. Sind es doch 17,5% der österreichischen Gesamtbevölkerung, die armuts- oder ausgrenzungsgefährdet sind. Wenig ist das also nicht. Im vermeintlichen Kampf gegen Armut strebt die Gesellschaft also den Angriff gegen Arme an, statt es wirklich mit der Armut aufzunehmen – ein wahres Armutszeugnis. Dabei zeigen Statistiken und Studien zur Einkommensschere und anderen Entwicklungen rund um unsere Gesellschaft, dass die Situation in Zukunft alles andere als rosiger wird. Stattdessen fördert die Unterhaltungsindustrie zusätzlich den Blick „nach unten“ und das Gefühl, etwas Besseres als jene zu sein, die noch ärmer dran sind – und die Betroffenen bleiben dabei auf der Strecke.
Womöglich ist es meine Vergangenheit, die mich für das Thema so stark sensibilisiert. Denn viele Menschen, die nicht am eigenen Leib erfahren mussten, was Armut bedeutet, scheinen häufig kein Gefühl dafür zu haben. Geschweige denn Verständnis. Doch unser System füttert all jene, die gegen Armut „haten“. Und grenzt jene aus, die es eben sind. Schamgefühl als Resultat und somit ein Ausbleiben jener Geschichten, die ehrlich und authentisch für Armut sensibilisieren.
Der Kampf in der Armut
Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als der Kühlschrank am Ende jedes Monats beinahe leer war. Neue Kleidung war eine absolute Ausnahme. Den Computer aus Restteilen selbst zusammengebaut. Schulausflüge? Fehlanzeige. Konnte man sich nicht leisten. Dafür bekam man stattdessen den Hohn der Mitschüler:innen zu spüren. Ja, Elternvereine schauen, dass sie einen Teil der Kosten übernehmen. Aber wenn nichts da ist, dann hilft einem auch das nichts. Wir haben es trotzdem immer irgendwie geschafft zu überleben. Und ja: Überleben. Denn um mehr geht es in der Armut nicht mehr. Immerhin waren sogar Warmwasser und Strom in manchen Monaten Luxusgüter. Und das, obwohl meine Mutter meist nicht nur einen Job hatte.
Es zieht sich durch die Generationen. Verschuldung, weil Rechnungen nicht gezahlt werden können. Anmelden von Strom etc. auf den Namen der Kinder, weil man sonst keinen mehr hat. Arbeiten gehen als Teenager neben der Schule – und somit ein automatischer Abfall schulischer Leistung. Bei mir kam noch die Pflege der Großeltern hinzu – also noch weniger Zeit. Weiter auf die Uni, wo irgendwann die Studienmaterialien nicht mehr leistbar waren. Geschweige denn das notwendige Essen. Jobs, die sich schwer mit dem Studium vereinbaren lassen. Mietrückstände. Und so geht es immer weiter. Ein ständiger Kampf, bis man es doch mit Glück vielleicht einmal aus der Abwärtsspirale schafft.
Als wäre Wegschauen das beste Mittel im Kampf gegen Armut – hinschauen nur dann, wenn es der Unterhaltung dient. Die Realität in Österreich ist grausamer als viele glauben, aber die Privatsender nutzen diese, um sich mit falschen Eindrücken mehr Geld in die Taschen zu spülen. Absurd: Denn es geht auf Kosten jener, die eh schon nichts haben. Uns in Österreich geht es natürlich verhältnismäßig gut. Doch die schlechtere Situation in anderen Teilen dieser Welt als Maßstab heranzuziehen, ist ganz klar der falsche Ansatz. Statt den Blick auf jene zu richten, die im Überfluss leben, der es ihnen gar unmöglich macht, jemals ihr Geld am Konto auch nur irgendwie auf null zu bringen, zeigen wir wieder mit den Fingern auf die Ärmsten der Armen.
Chancengleichheit? Auch im Sozialstaat nur ein Mythos
Während die Vermögenschere ständig wächst, beginnt beim weniger betuchten Bevölkerungsteil eine schwer zu durchbrechende Abwärtsspirale. Denn trotz des Sozialstaates, der zumindest ein Minimum an Lebensqualität sichert – beziehungsweise sichern sollte -, nimmt der Kreislauf der Armut bereits bei den Jüngsten ihren Anfang. Ein Bericht der Bertelsmann Stiftung zeigt, welche Einflüsse Armut bereits auf Kinder hat – nicht nur in monetären Fragen.
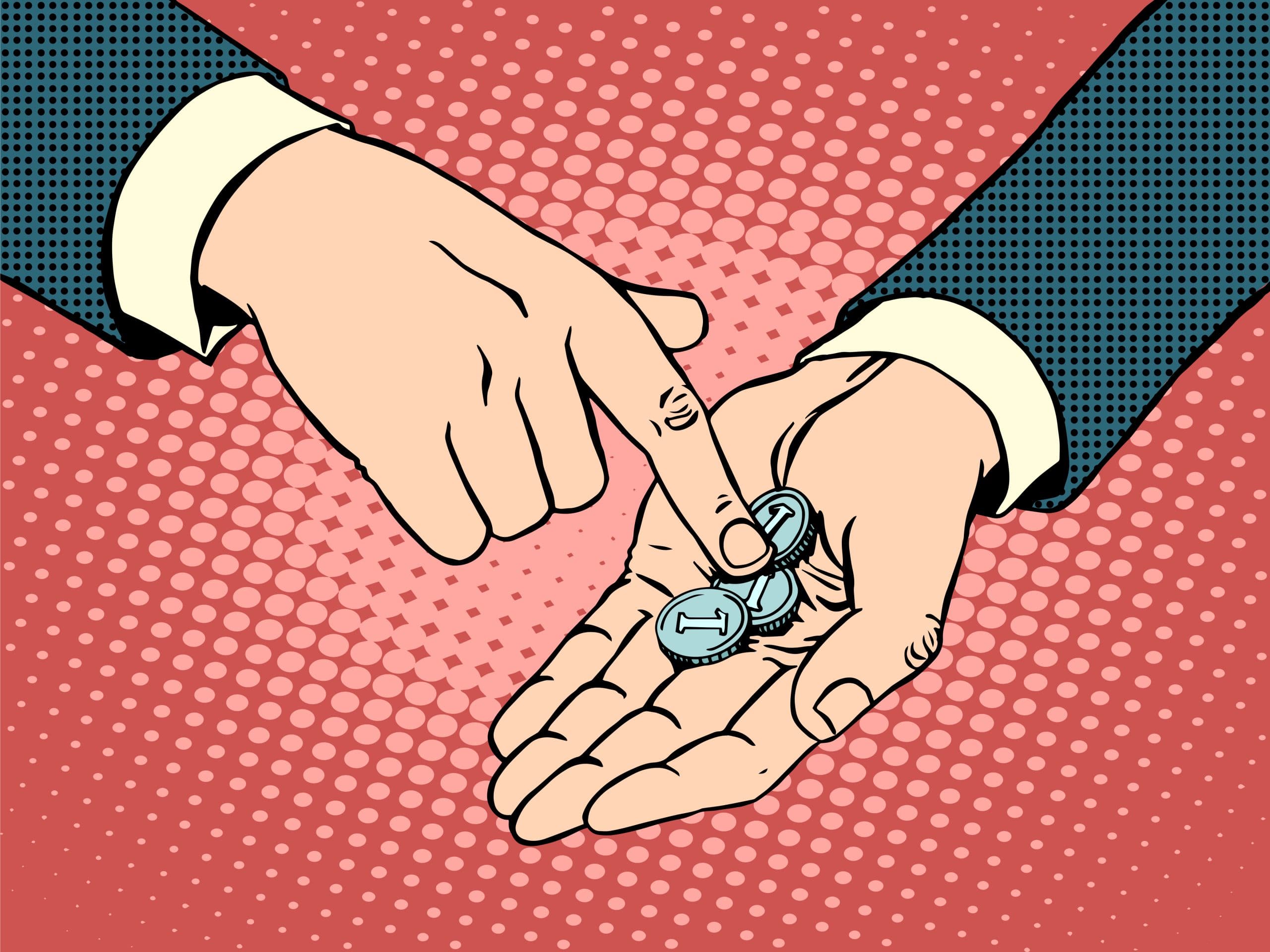
© Shutterstock
So zeigt der Bericht vier Faktoren, die das Leben des Kindes nachhaltig negativ beeinflussen. Erster Wirkmechanismus ist das Milieu: Das Viertel, in dem die Kinder aufwachsen, und der Kindergarten bzw. die Schule, die sie besuchen – was wiederum stark an finanzielle Mittel gekoppelt ist. Klar, dass das nähere soziale Umfeld abseits der Familie einen maßgeblichen Anteil des Umgangs und damit des Einflusses auf Persönlichkeit und Entwicklung ausmacht. Somit bilden sich dort auch Sprache, Interessen usw. in den Interaktionssphären mit anderen Gleichaltrigen aus.
Zweitens haben selbstverständlich auch Erwachsene Einfluss auf die Kleinen. Werte, Normen und Orientierungen entstehen in diesem Wirkmechanismus. So kann aber vor allem das Personal von Kindergarten und Schule auch eine positive Sozialisation erwirken – vorausgesetzt, die humanen Ressourcen sind gegeben, um auf die individuellen Bedürfnisse eingehen zu können. Merkt ihr schon, wie sich hier die Katze langsam in den Schwanz beißt?
Die unausgeglichene soziale Ungleichheit
Der dritte Wirkmechanismus betrifft die gesundheitliche und soziale Ungleichheit. Diese kann durch Förderprogramme, Jugendeinrichtungen, Sportprogramme, Familienzentren etc. minimiert werden. Doch einerseits braucht es eine flächendeckende Infrastruktur und wiederum einen effektiven Angriffspunkt bei Betroffenen.
Natürlich unterliegen meine angeführten Statistiken auch einer gewissen individuellen (!) Auslegung – doch die Daten der Statistik Austria zeigen 36.369 Kinder und Jugendliche im Rahmen der Unterstützung der Erziehung im Jahr , während es im Jahr 2020 mit 38.489 nicht maßgeblich mehr sind. 2015 befanden sich 1,178 Millionen Menschen an der Armutsgrenze und 1.529 Millionen Menschen hingegen im Jahr 2020 – also 400.000 Menschen mehr gegenüber 2000 Kinder und Jugendlichen mit Betreuungsanspruch.
Natürlich darf man hier die Zahlen nicht automatisch gegenüberstellen – immerhin wurde auch die Armutsgrenze im Schnitt um 300 € angehoben -, aber die Dimensionen zeigen dennoch deutlich, dass offensichtlich ein infrastrukturelles Defizit besteht.
Als viertes und letztes Glied der Kette stehen die Stigmatisierung und Diskriminierung. Alle Glieder fußen ineinander. Spannend bei dem vierten Punkt ist aber vor allem, dass es reine Umwelteinflüsse sind, die sogar noch durch Politik und die Unterhaltungsindustrie verschärft werden. In der Politik kennen wir das Stilmittel von Wirtschaftsparteien, sich an den Ärmsten abzuputzen.
Die Darstellung von Arbeitslosigkeit als Schmarotzerdasein, obwohl dafür Versicherungsleistungen erbracht wurden, oder beispielsweise Privatisierungen im Bildungsbereich und damit das Fördern der ersten drei Wirkmechanismen, sind vermeintlich zufällige Maßnahmen, die nicht der Wirtschaft dienen, sondern Armut fördern. Und die Unterhaltungsindustrie betreffend sind wir bei den anfangs genannten Reality-TV Formaten.
Assi TV, Fremdschämen, Stigmatisierung – wenn Armut zur Unterhaltung wird
Man könnte fast meinen, es gäbe ein kollektives Ziel „der Oberen“, die Armen als Feindbild zu etablieren, um selbst nicht ins Fadenkreuz zu geraten. Aber so weit würde ich mal bei den TV-Formaten nicht gehen. Kapitalismus ist hier viel mehr dem Moment geschuldet und somit einfacher gestrickt. Hohe Einschaltquoten und damit schnelle Umsätze sind das Ziel der Produktionsfirmen. Geld zu lukrieren mit dem Bedürfnis nach dem Gefühl der Überlegenheit.
Die kleine Frau und der kleine Mann, die tagtäglich ihrem 0815-Leben nachgehen, brauchen auch ab und an das Gefühl, etwas Besseres zu sein. Sonst würden auch sie womöglich einmal unter dem Druck der ständigen Klatschpresse-Nachrichten über die Reichen in ihren Villen, mit ihren Traumhochzeiten, ihren geilen Karren und den freshen Partys frustriert zurückbleiben.
Auf der primitivsten Ebene beginnt somit ein Dilemma. Während wir uns sozial weniger Privilegierte lustig machen, um uns für den Moment Überlegenheit zu erkaufen, vergessen wir dabei ganz darauf, warum es überhaupt solche Menschen gibt. Statt den Armen eine würdige Bühne zu bieten, um sich mutig über ihre Armut und ihre Geschichten zu äußern, fördern wir jene Sender, die mit gekonnten Bild- und Tonzusammenschnitten einen vollkommen falschen Eindruck vermitteln. Ein Trauerspiel.
Ist die Würde des Menschen etwa doch nicht unantastbar, wenn es darum geht, finanzielle Mittel damit zu generieren? Klar ist, dass es absolute Gleichbehandlung nur dort gibt, wo sich auch jemand dafür einsetzt, dass diese auch wirklich eingehalten wird. Und wie viele können sich schon einen Anwalt leisten oder wissen ob der öffentlichen Institutionen und Möglichkeiten Bescheid. In jedem Fall gehören solche TV-Formate verboten, wie auch die Verträge, die den Teilnehmenden für ein absurdes Handgeld vorgelegt werden. Hat doch Jan Böhmermann vor nicht allzu langer Zeit sehr deutlich gezeigt, wie sowas abläuft.
Titelbild © Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Krankheiten erfinden, Grenzwerte verschieben: wie manipulativ ist die Pharmaindustrie?
Den Trick der Pharmaindustrie, Altes als Neu zu verkaufen, kennen wir bereits. Kein Weg ist ihr zu schäbig und moralisch […]
Oatly Hafermilch: der Börsengang gegen die eigenen Prinzipien?
Mit seinem signature Haferdrink hat sich das kleine schwedische Unternehmen Oatly im Laufe der vergangenen Jahre zum konkurrenzfähigen Weltmarkt-Riesen gemausert. […]
Job Sculpting: Von besserer Aufgabenstellung zu mehr Motivation
Arbeitnehmer:innen sind in ihren Jobs immer mehr und mehr gefrustet und nur noch wenig motiviert, wie Studien belegen. Doch durch […]
Tschernobyl-Hunde: genetisch revolutionäre Veränderungen?
Was hat es mit den genetischen Veränderungen, die streunende Hunde rund um das zerstörte Kernkraftwerk Tschernobyl aufweisen auf sich?
Schizophren durch Cannabis - Kiffen schuld an jedem dritten Anfall?
Schizophrenie und Cannabis: Ist das Kiffen schuld an jedem dritten Schizophrenie-Anfall bei jungen Männern?
Bereits im Fokus der Kritik: Kronen Zeitung legt weiter nach
Jetzt ist schon wieder was passiert – als wäre die Live-Berichterstattung von Krone und oe24 zum Attentat nicht schon genug […]