“Friends will be friends, They’re running naked in the sand.”, heißt es in einem Kult-song über Freundschaft. Gesungen von der US-Ulk-Band Tenacious D, rund um die Spaßkanone Jack Black. Freundschaft ist wichtig. Und unsere Social-Media-Accounts sind geradezu voll von deren begehrtem Rohstoff: Freunde. Doch wie viele von diesen „Freunden“ sind wirklich noch Freunde? Und überhaupt, wie viele Freunde sind für den Menschen, wissenschaftliche gesehen, überhaupt „tragbar“?
Freundschaft – eine Frage des Gehirns
Auch wenn die Freundeszahlen in unseren Social-Media-Accounts, mithilfe der Empfehlungen usw. sukzessive in die Höhe schnellen. Niemand wird behaupten, jeden einzelnen davon wirklich so gut zu kennen, um ihn oder sie als (engen) Freund oder Freundin zu bezeichnen. Also als eine nahestehende Person. Fakt ist, es haben nicht alle Menschen denen Ihr begegnet, Platz in eurem Leben. Vor allem aber, haben nicht alle davon Platz in eurem Gehirn.
Klar, die Anzahl der Menschen, die in den unterschiedlich geführten Leben auftauchen, ist verschieden. Doch das menschliche Gehirn hat bei fast allen Menschen dieselben Kapazitäten. Heißt wissenschaftlich gesprochen: Ab einem Bekanntenkreis von mehr als 1500 Personen stößt ein jedes Gedächtnis auf seine Grenzen. Ihr könnt die dazugehörigen Gesichter vielleicht noch wiedererkennen. Doch Namen könnt ihr diesen kaum noch zuordnen. Geschweige denn, euch genauere Einzelheiten einprägen.
Was bedeutet: Die Zahl der Freundschaften ist begrenzt. Das ist eine Tatsache.
Gehirngröße bestimmt die Größe sozialer Gruppen
In diesem Bereich geforscht, hat der britische Anthropologe Robin Dunbar. Und dabei herausgefunden, dass unser Gehirn schon bei einer viel kleineren Zahl als 1500 an seine Grenzen stößt. Dunbar entdeckte, dass das menschliche Beziehungsgeflecht einem bestimmten Muster folgt und dabei maximal 150 Personen umspannt. Diese Zahl ging als die „Dunbar-Zahl“ in die Wissenschaftsgeschichte ein. Es sei angemerkt, dass diese Zahl ein durchschnittliches Maximum ist. Und einer Streuung von etwa 100 bis 200 Personen unterliegt.
Affengeil

Zu Beginn untersuchte Dunbar das Sozialverhalten der Primaten. Er stellte fest, dass die Größe sozialer Gruppen mit der Gehirngröße der Spezies korreliert. Ganz eindeutig bedarf es also „Grips“, um mit seinen „Artgenossen zu interagieren, sich zu verbünden und sich an frühere Begegnungen zu erinnern.“
Oder wie es die Psychologin Corinna Hartmann wissenschaftlich weiter formuliert: „Die Menge der Neuronen im Neokortex bestimmt demnach die Verarbeitungskapazität für soziale Information und begrenzt so die Anzahl der Kontakte, die ein einzelner Primat gleichzeitig aufrechterhalten kann. Wachsen Gruppen über das speziestypische Limit hinaus, zerfallen sie, weil die Tiere es nicht mehr schaffen, ihre Beziehungen zueinander zu koordinieren. Entsprechend der Größe ihres Neokortex haben zum Beispiel Schimpansen einen größeren Freundeskreis als Lemuren.“
Als Robin Dunbar dann im nächst-logischen Schritt anfing, den Menschen anhand eben dieser Methode zu „vermessen“, kam er auf die berühmte „Dunbar-Zahl“ 150. Und da der Mensch (im Vergleich mit den Primaten) den größten Neokortex hat, ist diese Zahl damit recht beachtlich.
Sprache als der Leim, der uns Menschen zusammenhält
Doch Gemeinschaftssinn hat seine Grenzen. Nicht nur aufgrund geistiger Kapazitäten, sondern auch wegen der verfügbaren Zeit. Aufgrund dessen vermutete Dunbar auch, dass Sprache erst entwickelt wurde, als die sozialen Gruppen dermaßen anwuchsen, dass es einen anderen Ansatz nach Nähe bedurfte.
Der Mensch benötigte also eine Alternative zum gegenseitigen Putzen und Entlausen, um sich nahe zu sein. Wie das z.B. bei den Affen der Fall ist. Die Lösung: Sprache. „Verbale Streicheleinheiten ließen sich schließlich an mehrere Kumpane gleichzeitig verteilen und ermöglichten nebenbei noch andere Tätigkeiten.“, so Corinna Hartmann.
Trotz unseren sprachlichen Fähigkeiten und der schieren Endlosigkeit an Wortkombinationen und Gesprächsstoff, ist Zeit jedoch auch heute noch ein begrenzender Faktor. Daher hat sich die „Dunbar-Zahl“ über die Jahre auch nicht groß verändert.
Die Genealogie der Freundschaft

Auch wenn die Anzahl unserer Freundschaften von der „Dunbar-Zahl“ beschränkt wird, so sind wir mit allen unseren (um die 150) Freunden nicht gleich eng verbunden. Denn auch die „Dunbar-Zahl“ lässt sich aufteilen und Subkategorien.
Laut den neuesten Erkenntnissen würden die meisten von uns 10 bis 15 Personen als Freunde bezeichnen. Auf diesen kleinen Kreis an Menschen können wir uns in allen Lebenslagen verlassen. Die Besetzung dieser 10 bis 15 Auserwählten ändert sich zwar im Laufe der Jahre. Die Zahl selbst bleibt dabei jedoch überraschend konstant. Drei bis fünf von diesen Freunden sind unsere engsten Vertrauten. Das sind alle jene, mit denen wir öfter Kontakt pflegen und denen wir unsere Sorgen, Geheimnisse und Ängste anvertrauen.
Im erweiterten Kreis innerhalb dieser 150, finden sich die guten Bekannten. All jene, die wir z.B. zu unserem Geburtstag oder unserer Hochzeit einladen würden. Das wären um die 50 Personen. Mit dem Rest haben wir irgendeine soziale Beziehung, die auf Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung basiert. Darunter Nachbarn und Kollegen. Alle anderen Kontakte ähneln eher lockeren Bekanntschaften und sind mit keinerlei Verpflichtungen verbunden, außer dass man sich vielleicht grüßt etc.
Digitale Freundschaft
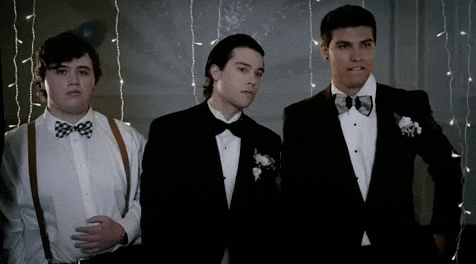
Unser Gehirn hat Grenzen. Aber nicht das Internet. Die Möglichkeiten sich dort zu vernetzen scheinen grenzenlos. Statistisch gesehen liegt die Durchschnittsanzahl an Freunden auf Facebook bei 338 Personen. Also mehr als doppelt so hoch wie die „Dunbar-Zahl“. Aber erweitern diese sozialen Hilfsmittel wirklich unseren Freundeskreis? Die Antwort: Nein!
Forscherinnen und Forscher an der School of Informatics and Computing der University of Indiana fanden 2011 heraus, dass auch Online maximal 100 bis 200 Kontakte aufrechterhalten werden konnten. Unsere geistige Begrenztheit, was Freundschaften betrifft, wirkt somit auch online.
New Age Of Friendnship
Trotzdem sind die Sozialen Medien dazu in der Lage, unsere Jahrtausende alten Beziehungsgeflechte zu verändern. „Via Facebook, Instagram & Co. können wir leichter Kontakt zu alten Schulfreunden halten, ausgewanderte Bekannte auf den neusten Stand bringen und so unser soziales Netz insgesamt ausweiten.“, ist Hartmann überzeugt.
Umfragen aus den USA belegen, das die Zahl der Freundschaften erwachsener Amerikaner zwischen 2002 und 2007 leicht gewachsen ist. Und Tatsache ist, dass die meisten sozialen Beziehungen diejenigen haben, die viel Zeit online verbringen. Vor kurzem hat Robin Dunbar höchstpersönlich die Dunbar-Zahl sogar auf 180 erhöht. Begründung dafür: Das Aufkommen der Social Media seit seiner Forschung Anfang der 1990er Jahre. Die neuen Technologien, lange schon die Erweiterung der menschlichen Kapazität. Stichwort: Human Enhancement.
Titelbild Credits: Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
CORONA - Best Of der Verschwörungstheorien inklusive Gegendarstellung
Das Corona Virus lockt sie zahlreich aus ihren Löchern: die Propheten und Verschwörungstheoretiker. Waren diese bis dato fast arbeitslos, so haben sie nun wieder eine Aufgabe - nämlich die Welt gefühlt alle 5 Minuten mit neuen Informationen und Erkenntnissen zu füttern. Bewaffnet mit brennenden Fackeln, Mistgabeln und jeder Menge Wissen von natürlich absolut seriösen Webseiten mit unfassbar geheimen Quellen. Die besten, kuriosesten und spannendsten Theorien habe ich nun für euch zusammengefasst.
Selective Outrage – Chris Rocks späte Rache an Will Smith?
Ein Jahr nach dem Will Smith Ohrfeigen-Skandal der Oscars meldet sich Chris Rock mit einer komödiantisch tiefsinnigen Comedy-Show zu Wort.
TechMagnet im Interview über die Sperre seines TikTok-Kanals
TechMagnet ist einer der reichweitenstärksten Technik und Technologie Influencer auf TikTok in Österreich. Doch nun wurde sein Kanal gesperrt!
Mastodon: Die bessere Twitter-Option?
Hast du schon mal von Mastodon gehört? Bei uns erfährst du, was es damit auf sich hat und was sich hinter der Twitter-Flucht verbirgt.
She-Hulk – Disney+ Serie als behäbiger Versuch, das Marvel-Universum frauenfreundlicher zu machen
Das Marvel-Universum hat wieder Zuwachs bekommen. Die Cousine vom Hulk betritt mit ihrer eigenen Serie She-Hulk die Bühne. Was durchaus als ein Format mit interessanten Ansätzen erscheint, entpuppt sich leider recht schnell als more of the same shit – nur eben in grün.
Das Corona Russian Roulette - was ist das für ein Trend?
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher“ - das trifft den neuesten, von amerikanischen - surprise surprise! - Jugendlichen geleiteten Trend hervorragend und lässt wieder mal an der Intelligenz des Menschen zweifeln.















