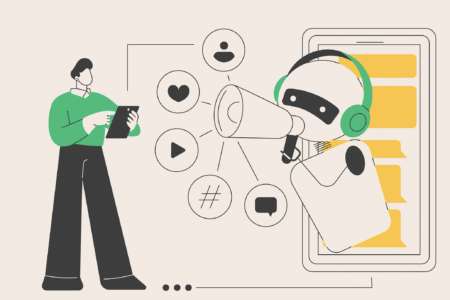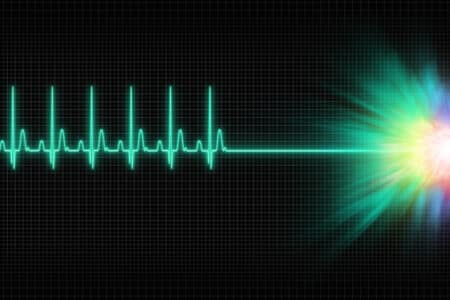Trotz Gruppenchats, DMs und hunderten Follower*innen fühlen sich heute so viele junge Menschen einsam wie noch nie. Klingt paradox, ist aber bittere Realität. Die Einsamkeit unter jungen Erwachsenen hat in den letzten Jahren weltweit drastisch zugenommen. Und das nicht nur wegen Corona. Dabei sind Menschen heutzutage ständig vernetzt. Doch warum leben gerade junge Erwachsene weltweit zunehmend isoliert?
Nur ein bisschen Langeweile?
Laut einer internationalen Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov fühlten sich 30 Prozent der Millennials (Geburtsjahrgänge 1981–1996) „häufig“ oder „immer“ einsam. In den USA gab laut einer Studie der Harvard Graduate School of Education 2021 mehr als jeder zweite junge Erwachsene (18–25 Jahre) an, sich „ernsthaft oder häufig“ einsam zu fühlen. Auch in Großbritannien, Kanada und Australien zeigen Studien ähnliche Trends.
Dabei reden wir nicht von gelegentlicher Langeweile an einem verregneten Sonntag, sondern von einer tiefgreifenden sozialen Isolation, die psychisch und körperlich krank machen kann. Gerade junge Erwachsene trifft es besonders hart. Sie sind in einer Phase zwischen Schule, Studium, ersten Jobs und Identitätssuche oft besonders verletzlich. Der permanente Leistungsdruck, der Vergleich über Social Media und das Fehlen echter, stabiler Beziehungen wirken wie ein Katalysator.
Einsamkeit ist kein Zufall, denn sie ist systemisch gewollt
Die wachsende Einsamkeit junger Menschen ist kein tragischer Nebeneffekt der Moderne, sondern ein Symptom einer Gesellschaft, die auf Vereinzelung baut, um effizient zu funktionieren. In einer neoliberalen Leistungsgesellschaft ist das Kollektiv nicht vorgesehen. Gebraucht werden flexible, anpassbare Einzelkämpfer*innen, die funktionieren, liefern, konsumieren.
Wer isoliert ist, organisiert keinen Widerstand. Wer allein ist, stellt keine Machtfrage. Die Ideologie dahinter ist klar. Du bist für dein Glück selbst verantwortlich. Und wenn du dich schlecht fühlst, musst du halt härter an dir arbeiten.
Gerade junge Erwachsene geraten so in einen perfiden Kreislauf. Denn um in der Leistungsgesellschaft zu bestehen, opfern sie Beziehungen, Freizeit, sogar Identität. Gruppenzugehörigkeit wird ersetzt durch Wettbewerbsdenken. Echte Freundschaften weichen funktionalen Netzwerken. Die Trennung von privater Nähe und öffentlicher Performance wird so normal, dass viele gar nicht mehr wissen, wie sich Verbundenheit eigentlich anfühlt.
Diese Vereinzelung ist kein Zufall, sondern politisch und wirtschaftlich funktional. Ein starkes Wir-Gefühl würde Fragen stellen. Deshalb wird das soziale Gefüge von innen heraus zerlegt. Nicht mit Gewalt, sondern mit Tempo, Konkurrenz, Selbstoptimierung. Und so bleibt jede*r für sich. Effizient, erschöpft und einsam.
Auch in Österreich ist Einsamkeit ein stilles Massenphänomen
Auch in Österreich ist Einsamkeit längst kein Randthema mehr. Laut einer Studie der Caritas und Foresight aus dem Jahr 2023 fühlen sich rund 600.000 Menschen regelmäßig einsam. Das sind mehr als die Einwohnerzahl von Graz und Linz zusammen gezählt. Besonders betroffen sind Menschen mit geringem Einkommen, die sich soziale Aktivitäten schlicht nicht mehr leisten können. Inflation, Wohnkostenexplosion und steigende Lebenshaltungskosten treiben nicht nur viele in finanzielle Engpässe. Sie führen auch zu sozialer Isolation.
Junge Erwachsene sind davon nicht ausgenommen. Zwar gibt es für Österreich keine gesonderten Zahlen zur Einsamkeit dieser Altersgruppe. Doch EU-weite Studien zeigen deutlich, dass Menschen unter 30 europaweit zu den am stärksten Betroffenen zählen. Österreich folgt diesem Trend. Gleichzeitig liegt die offizielle Einsamkeitsrate laut EU-LS 2022 hierzulande niedriger als in anderen Ländern. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Einsamkeit bei jungen Menschen oft unsichtbar bleibt. Sie posten. Sie liken. Sie wirken vernetzt: Aber viele leiden im Stillen.
Die Ursachen sind strukturell. Bildung, Job, Wohnung. Alles wird teurer, instabiler, anonymer. Wer nicht mithalten kann, fällt durch das Raster. Und wer versucht, mitzuhalten, hat oft keine Energie mehr für echte soziale Bindungen. Was bleibt, ist das Gefühl, allein zu sein, obwohl ständig Menschen um einen herum sind.
Titelbild © Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Der Brand in Tschernobyl - Einblicke zur Katastrophe direkt aus Kiew
Die Angst vor einer radioaktiven Wolke ist groß, doch ist diese verhältnissmäßig noch weit weg von uns, betrachten wir die nahegelegene Ukrainische Hauptstadt. Wir haben uns mit Fjodor K. aus Kiew über die Wahrnehmung in unmittelbarer Nähe unterhalten und ihn nach seiner Sicht der Dinge gefragt.
Massen-Kündigungen bei Twitter: Diskriminierung oder Notwendigkeit?
Elon Musk hat mit Massenentlassungen für Aufsehen gesorgt. Nun reichen Betroffene Klagen gegen die Kündigungen ein!
State of the Union: Eheprobleme, verpackt in geniale Mini-Serie
Rosamund Pike und Chris O’Dowd brillieren als herrlich verschrobenes Paar vor der Trennung in Stephen Frears Mini-Serie State of the Union.
Rassismus, Privilegien und White Fragility - #blacklivesmatter nur ein klitzekleiner Schritt
Auf den #blacklivesmatter-Demonstrationen kommen dieser Tage weltweit Menschen zusammen, um Solidarität zu zeigen im Kampf gegen Rassismus. Das ist ein gutes Zeichen, doch damit die Bewegung Erfolg hat, braucht es viel mehr - davon sind auch bekennende Anti-Rassisten nicht ausgenommen.
Nahtoderfahrungen: Real oder doch nur Konstruktion des Gehirns?
Sind Nahtoderfahrungen real oder doch nur Fiktion? Wissenschaftler*innen haben sich dieser Frage gewidmet.
Italien: 6 Jahre Haft für Techno Veranstalter
Italienische Behörden haben mit einer 300 Polizisten starken Einheit eine friedliche Rave-Party aufgelöst. 3.000 Neo-Faschisten ließ man in Mussolinis Heimatort jedoch unbehelligt „feiern“. Darüber hinaus will man mit einem neuen Gesetz gegen Rave- und Techno-Veranstaltungen vorgehen. Was ist los in Italien?