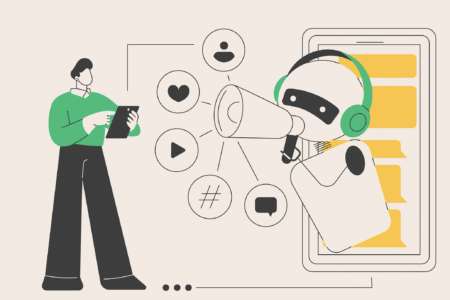Die ethnische Vielfalt nimmt in den meisten fortgeschrittenen Ländern zu. Diversität gilt als zukunftsweisende Möglichkeit. Eine Studie fand jedoch heraus, das ethnische Vielfalt dazu führt, dass die soziale Solidarität und das soziale Kapital sich verringern. Scheitert also unsere Utopie einer diversen Gesellschaft?
Vorurteile auf dem Vormarsch
Vorurteile sind das schwierigste Thema überhaupt. Warum? Weil wir dazu tendieren, dies nur an anderen wahrzunehmen und nicht an uns selbst. Was dazu führt, dass niemand Vorurteile hat. Denn, wenn jeder allen anderen ebendiese unterstellt, sich selbst bei dieser Rechnung aber herausnimmt, dann kommt man genau zu diesem Ergebnis. Vorurteile: es gibt sie nicht. Und doch ist es eine traurige Tatsache, dass die Neigung zu Vorurteilen in uns allen steckt. Und das ist sogar wissenschaftlich erwiesen.
Teilweise entstehen unsere Vorurteile durch die Eingebundenheit in unsere Kultur, die uns durch unser Umfeld vermittelt wird. Ebenso spielt auch eindimensionale Medienberichterstattung eine Rolle – vor allem das Leben in sozialen Blasen.
Vorurteile – unser evolutionäres Erbe
Aber Vorurteile sind vor allem als Teil unseres evolutionären Erbes tief in uns verwurzelt. Die menschliche Spezies entwickelte sich nämlich in kleinen Stammesgemeinschaften, deren Mitglieder durch eine starke soziale Identität miteinander verbunden waren. Diese mitunter radikale Gruppenidentifikation war natürlich gut für die Bindung untereinander und gewährleistete die Kooperation innerhalb der Gruppe.
© Shutterstock
Nebenprodukt dieser wichtigen Veranlagung zum Teamwork war und ist jedoch der Konkurrenzkampf zu anderen Stammesgemeinschaften. Somit spalteten sich Bereiche in Innengruppen und Außengruppen. So entstanden sogenannte „Othering“-Geschichten, die auf eine Differenzierung und Distanzierung der Eigengruppe von den anderen, den „Fremden“ hinwiesen.
Vorurteile – heute so aktuell wie damals
Es ist natürlich eine Tatsache, dass wir einen weiten Abstand geschaffen haben. Von damals zu heute. Teil der kleinen Stammesgemeinschaften, die irgendwo ihr Lager aufgeschlagen hatten, um sich am gemeinsamen Feuer zu wärmen und jeder Zeit Gefahr liefen, von rivalisierenden Stämmen angegriffen zu werden, sind wir schon lange nicht mehr. Doch wie so oft verharrt unser Verstand immer noch in denselben alten Mustern von damals. Heißt: Wir gegen die anderen ist immer noch eine Parole, unter der wir leben müssen.
Sogar Studien belegen, wie stark dieser uralte Trieb immer noch in uns ausgeprägt ist. Diese teilten die Teilnehmenden in zwei Gruppen. Die Zugehörigkeit war total arbiträr und wurde durch Münzwurf entschieden. Und obwohl alle wussten, dass nur der Zufall und nichts sonst diese Zuordnung entschieden hat, begannen die Probanden und Probandinnen ihre Gruppe, als die bessere von beiden zu betrachten.
Instinktgesteuerte Differenzierung bleibt unüberwindbar
Diese triebgesteuerte Differenzierungspraktik ist natürlich überholt und veraltet. Wir Menschen gehören alle derselben Gattung an. Und das sogar jenseits jedwedes moralischen und ethischen Ansatzes. Das ist eine rein biologische Tatsache. Die Genforschung hat bewiesen, dass alle Menschen auf der biologischen Ebene „aus dem gleichen Holz geschnitzt“ sind.
Vor noch nicht allzu langer Zeit hatten wir alle dieselben Vorfahren. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn diese wissenschaftlichen Erkenntnisse genügen würden, um diesen Abgrenzungen ein Ende zu setzen. Aber leider haben Forschungen auch ergeben, dass die Neigung zur Distanzierung und Differenzierung von der Evolution vorprogrammiert ist.
Diversität ist nicht ausreichend für Veränderung
Die Sozialwissenschaft hat immer wieder behauptet, durch die fortwirkende Erweiterung und Vielfalt gesellschaftlicher Strukturen werde der Abbau von Vorurteilen unumgänglich. Doch die Dinge sind leider etwas komplexer als angenommen.
Und wenn man recht bedenkt, war das ja auch irgendwie klar. Denn sogar die geschlechterspezifische Voreingenommenheit ist tief in uns allen verwurzelt. Und das, obwohl Frauen und Männer seit Menschengedenken in einer engen Wechselbeziehung zueinanderstehen. Wenn die alleinige Anwesenheit des „Anderen“ so etwas wie Verbundenheit injizieren soll, warum denken sich dann Männer und Frauen immer noch nicht zusammen, wo sie doch schon seit Anbeginn der Zeit zusammen in denselben Gruppen und Kleinstgruppen bis hin zur Kernfamilie ausharren müssen?
Studie bestätigt: je vielfältiger Gesellschaft, desto geringer das Vertrauen
Sogar eine Studie zu den Auswirkungen der Vielfalt auf das Leben sozialer Gemeinschaften gibt es. Ernüchterndes Ergebnis davon: Je vielfältiger die Gesellschaft, desto geringer das Vertrauen anderen Menschen gegenüber. Selbst wenn diese zur eigenen Gruppe gehören, wird den Menschen misstraut.
Auch die Anzahl derjenigen, die an Wahlen teilnahmen, einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgingen oder aktiv an Projekten ihrer Gemeinde mitarbeiteten, war geringer. Mit anderen Worten: die wachsende Vielfalt lässt immer mehr Menschen sich aus gemeinschaftsbildenden Prozessen sausklinken. Es reicht somit nicht aus, in einer vielfältigeren Welt zu leben, um die Vorteile der Diversität genießen zu können.
Bezugsrahmentheorie (RFT) als Alternative gegen Vorurteile
Das größte Problem dabei ist, dass die Voreingenommenheit tief in unserem Denken eingebettet ist. Es gibt umfangreiche Studien über sogenannte stillschweigende Vorurteile – negative, schablonenhafte Vorstellungsbilder und Abgrenzung zu anderen –, derer wir uns oft gar nicht bewusst sind.
Die Bezugsrahmentheorie (RFT) bietet derzeit eine Möglichkeit, stillschweigende Annahmen und Vorurteile aufzudecken. Und eine Veränderung unserer Denk- und Fühlweise diesbezüglich wäre bitter nötig. Denn die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Menschen negative Vorstellungsbilder von denjenigen im Kopf haben, die nicht ihrer eigenen Gruppe angehören.
Unser Denken verändern
Vorurteile schleichen sich leicht ein. Ob es uns gefällt oder nicht. Und egal, für wie aufgeklärt wir uns auch halten. Wenn wir diese Vorurteile also wirksam bekämpfen wollen, müssen wir die Art und Weise ändern, wie unser Verstand mit ihnen umgeht. Wir müssen moderne mentale Strukturen für die moderne Welt schaffen, in der wir heute leben, um eine gute Zukunft für alle zu gewährleisten.
In einer Studie, die herausfinden wollte, welche psychischen Faktoren Menschen dazu veranlassen, sich mehr als andere in einer Haltung der anmaßenden Distanzierung und Differenzierung einzurichten, entdeckt man drei charakteristische Merkmale:
- Die Unfähigkeit, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen
- Die Unfähigkeit, den Schmerz anderer nachzuempfinden
- Und die Unfähigkeit, emotional offen für den Schmerz anderer zu sein, wenn man ihn spürt.
Wenn diese drei Prozesse jedoch in eine positive Richtung gelenkt werden – um Flexibilität und innere Verbundenheit zu fördern –, werden nicht nur Vorurteile abgebaut. Sondern auch das Vertrauen zu anderen Menschen und die Freude an ihrer Gesellschaft aufgebaut. Nach dem Psychologen Steven c. Hayes gibt es hierbei drei wichtige Punkte zum Abbau von Vorurteilen:
-
Eingestehen
Es gilt: Einen Schritt zurücktreten und seine eigenen Neigungen wahrnehmen, aufgrund welcher man negative Werturteile über andere fällt. Oder Vorurteile auf der Grundlage der eigenen Privilegien erkennen, die auch ein Grund für Abneigung sind. Dazu nötig sind Mitgefühl und emotionale Offenheit.
-
Einfühlen
Nehmt bewusst die Perspektive derer ein, über die euer Verstand negative Werturteile fällt, und spürt, wie es ist, Stigmatisierung und Vorurteilen ausgesetzt zu sein, die durch diskriminierendes Verhalten zum Ausdruck kommt, und oftmals unbewusst ist.
-
Engagiert handeln
Lenkt das Unbehagen der Akzeptanz und den Schmerz der emotionalen Verbindung in die Motivation, zu handeln. Verpflichtet euch innerlich, konkrete Schritte einzuleiten, mit denen ihr den Auswirkungen von Vorurteilen und Stigmatisierung entgegenwirkt. Das bedeutet, aufmerksamer zuzuhören. Den eigenen Standpunkt deutlich zu machen, wenn in Scherzen oder Witzen Vorurteile ans Licht kommen. Die Verantwortung für die eigene Voreingenommenheit zu übernehmen und zu kommunizieren. Einen Schritt zurücktreten, damit andere vortreten können. Freundschaften mit Angehörigen von Gruppen zu schließen, den euer Verstand diskriminiert.
Fazit
Diversität ist ein Phänomen, das in einer global-vernetzten Welt unvermeidbar ist. Wenn wir uns selbst ein gutes Zusammenleben mit anderen gewährleisten wollen, müssen wir uns endlich unserer prähistorischen-Schwäche, dieser Vorurteils-Disposition bewusstwerden. Und aktiv etwas dagegen unternehmen. Den unvermeidlichen gesellschaftlichen Wandel der ethnischen Vielfalt in etwas Positives zu verwandeln, erfordert ein aktives Handeln. Nur so schaffen wir es, der Diversität als Utopie einen Schritt näher zu kommen.
Titelbild © Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Stereotype und Sexismus in der Werbung - wenn falsche Rollenbilder prägen
Sexismus und Stereotypen waren und sind noch immer ein omnipräsentes Thema dieser Gesellschaft, egal ob für Männer oder Frauen – […]
Der Coaching-Boom: Hilfreich oder Wahnsinn?
Immer mehr Menschen besuchen Coachings, um Unterstützung zu bekommen. Doch die Methoden vieler Coaches sind fragwürdig. Abzocke-Alarm!
Netflix‘ Lady Chatterley und der Liebhaber
Netflix hat sich an die Verfilmung einer Ur-Affäre herangewagt. Die Frage: Ist Netflix Lady Chatterleys Liebhaber ein gelungener Affären-Film?
Der Rammstein-Skandal: klassische Afterpartys oder systematische sexuelle Übergriffe?
Der Rammstein-Skandal rund um Till Lindemann. Wir haben die Ereignisse rund um die Missbrauchsvorwürfe chronologisch für euch aufbereitet.
Diskussion um CBD: Was steckt hinter den Plänen der EU-Kommission?
Die EU-Kommission schießt sich auf das derzeit legale CBD ein und zielt darauf ab, dieses als Suchtmittel zu deklarieren. Eine […]
Botanischer Sexismus: warum deine Allergie schlimmer wird
Immer mehr Menschen leiden an Allergien. Die Zahlen sind erschreckend. Doch woran liegt das? Am botanischen Sexismus?