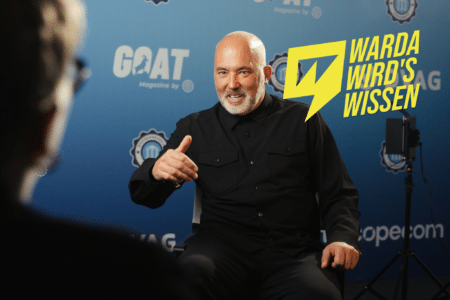Habt ihr euch schon gewundert, was wohl die seltsamsten Sprachen der Welt sind? Wir von WARDA auch! Daher haben wir diesbezüglich wieder eine unserer bewehrten Listen für euch zusammengestellt. Mithilfe des kürzlich erschienen Buches „Die seltsamsten Sprachen der Welt“ ist es uns gelungen, so einige Kuriositäten für euch zu entdecken.
Was ist seltsam?
Zu Beginn seines Werks klärt uns Harald Haarmann – einer der bekanntesten Sprachwissenschaftler weltweit – darüber auf, dass es rein subjektiv ist und von den eigenen Vorkenntnissen und Perspektiven abhängt, ob man etwas Fremdes seltsam findet oder nicht. Das Seltsame liegt daher immer im Auge der Betrachtenden. Verständlich, denn die eigene Muttersprache, mit der man aufgewachsen ist, scheint das Normalste zu sein.
Dass dem jedoch nicht so sein muss, zeigt eine andere Rangliste der seltsamsten Sprachen der Welt, laut derer Deutsch den 10 Platz einnimmt. Einer Sprache, von der wir im deutschsprachigen Raum vermutlich überzeugt sind, die Normalste zu sein. Dafür käme Hindi uns wohl als seltsam vor. Doch gilt Hindi laut diesem Ranking, als die „normalste“ Sprache. It’s a crazy world. Wie dem auch sei. Hier unsere Liste.
1. Mazatekisch
Mazatekisch ist eine indigene Sprache aus Mexiko. Um genauer zu sein: aus der Region Oaxaca. Das „seltsame“ an dieser Sprache ist, das dort mit Pfeiflauten kommuniziert wird. Wie bei fast allen Sprachen gibt es auch hier einen logischen Grund, warum das so ist.
Die Mazateken waren gezwungen, über weite Entfernungen hinweg zu kommunizieren. Zum Beispiel von einem Hügel zum nächsten. Da ist die präzise Pfeifform, die wie ein Vogelgesang anmutet und daher im Dschungel nicht auffällt, ein weitaus besseres Kommunikationsmittel als Sätze und Worte, die jedes Tier im Umkreis aufschrecken und flüchten lassen.
2. Mixtekisch
Das Mixtekische stammt aus derselben Region wie das Mazatekische. Aus dem mexikanischen Oaxaca, eine Region mit etwas über 4 Millionen Einwohner und knapp 162 indigenen Sprachen.
Beide Sprachen gehören zur Sprachfamilie der Otomangue-Sprachen. Das Besondere am Mixtekischen ist u.a. dass die Sprache keine Möglichkeit hat, Frage- von Aussagesätzen zu unterscheiden. Aussagen wie „Geht es dir gut?“ und „Du bist wohlauf.“ klingen genau gleich.
3. Hopi – auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Lange Zeit wurde vermutet (u.a. vom Sprachforscher Benjamin Lee Whorf), die Hopi hätten kein Gefühl für Zeitabläufe und deshalb gebe es in dieser Sprache keine Ausdrucksformen zur Unterscheidung von Zeitstufen (Tempuskategorien). Tatsache ist (laut Haarmann) jedoch, dass es in der Hopi-Sprache keine Unterschiede zwischen Präsens- und Vergangenheitsformen gibt. Einen Satz wie „momoyam piktota“ kann man laut Haarmann unterschiedlich übersetzen: „Die Frauen machen Piki.“ (Präsens) oder „Die Frauen machten Piki.“ (Vergangenheit). Piki by the way ist ein aus blauem Maismehl hergestelltes Fladenbrot.
Bei genauerer Betrachtung ist jedoch festzustellen, dass die Hopi-Sprache durchaus Unterschiede zwischen Jetztzeit und Vergangenheit hat. Allerdings nicht in flektierten Verbalformen, sondern mithilfe von Adverbien wie „vor langer Zeit“, „gerade eben“ oder „immer noch“.
Haarmann stellt fest: „Was Whorf bei seiner Betrachtung entgangen war, ist der Sachverhalt, dass die zentrale Unterscheidung bei den Hopi nicht wie in den meisten anderen Sprachen die zwischen Präsens und Vergangenheit ist, sondern die zwischen Zukunft und Nichtzukunft. Der Unterschied ist, dass der Sprecher Geschehen in der Vergangenheit und in der Jetztzeit „erlebt“, was für zukünftige Erfahrungen nicht der Fall ist.“
Um ein paar Worte Hopi zu lernen, bietet euch dieses Video ein nettes Intro:
4. Somali – eine aufgefächerte Skala an speziellen Bezeichnungen
Oft gibt es in einer Sprache nur grob unterschiedene Ausdrücke. In einer anderen Sprache gibt es für denselben Gegenstand mitunter jedoch eine breite Palette an Bezeichnungen. „Das hängt“, laut Haarmann „damit zusammen, ob es im kulturellen Umfeld dafür einen Anreiz oder sogar eine Notwendigkeit gibt.“ Für uns Europäer ist ein Kamel zum Beispiel ein Kamel. Es ist nicht notwendig für uns, mehrere und detailliertere Bezeichnungen dafür zu verwenden. Soweit so gut. Für jemanden der seinen Lebensunterhalt mit Kamelen verdient, gibt es jedoch viele Aspekte in der Beziehung von Mensch und Kamel, die es zu spezifizieren gilt.
So auch die Viehnomaden aus Somalia. Seit historischen Zeiten hat sich in dieser Sprache eine verzweigte Terminologie zur Kamelzucht entwickelt. Die erhöhte Aufmerksamkeit, die diesem Tier aufgrund der Zucht und des Handels gewidmet wurde, spiegelt sich im Wortschatz wider. Dort gibt es über 200 Ausdrücke, welche die Kamele unterscheiden. Für ihre besonderen Eigenschaften und Verhaltensweisen. Ihre verschiedensten Funktionen als Lasttier, Reittier, Nahrungsquelle (Milch und Fleisch) und vieles mehr.
Weitere Beispiele mit ähnlicher Vertiefung an Worten für einen bestimmten Gegenstand sind die Inuit mit ihrem profunden Wortschatz für Eis. Und die Samen (aus Nordskandinavien) mit ihrer Ausdrucksvielfalt bezüglich des Schnees. (Grund dafür ist übrigens deren Rentierzucht.)
All jene, die sich tiefer mit der Thematik Kamelzucht auseinandersetzen wollen, empfehlen wir diesen Link: 46 Somali Words for Camel
5. Finnisch und die verschiedenen Formen des „nein“
In allen Sprachen gibt es grammatische Formen der Verneinung. Klar. In allen Gemeinschaften ergeben sich Situationen, wo die Antwort auf eine Frage entweder positiv oder negativ ausfällt. Es gibt jedoch Kulturen in denen ein direktes „Nein!“ als zu schroff empfunden wird.
Als Alternative dazu behilft man sich mit Floskeln, an denen man dann erkennt, dass es sich um eine negative Stellungnahme handelt. Solch umschreibende Muster findet man laut Haarmann Großteils im Nahen Osten (in arabischsprachigen Gemeinschaften), in Südostasien und Japan.
Doch soweit muss man gar nicht erst reisen, um diesbezüglich auf Seltsamkeiten zu stoßen. In Finnland z.B. drückt man negative Stellungnahmen auf ganz andere Weise aus, als mit einer konkreten Verneinung. Es gibt zwar einen allgemeinen finnischen Verneinungspartikel: „ei“ (nein).
„Wenn es aber darum geht, eine Verneinung im Zusammenhang mit einer Verbform zu formulieren, dann geht das Finnische ganz ungewöhnliche Wege.“, erläutert Haarmann. Das finnische Verneinungsverb besitzt trotz der Verbindungen in der Konjugation keine Eigenbedeutung, sondern allein die Funktion, etwas zu verneinen. Wenn zum Beispiel die Frage gestellt wird „Kommt ihr auch mit?“, dann lautet die verneinende Antwort nicht „ei“ (nein), sondern „emme“ (wir nicht). Das allgemeine „ei“ – auch wenn inhaltlich als Verneinung klar ausgedrückt – klänge für Finninnen und Finnen mehr als seltsam.
6. Erfahrungen aus erster oder zweiter Hand – das Jukagirische
Ein Traum für alle Juristinnen und Juristen ist wohl diese Sprache. Jukagirisch. Diese Sprache aus dem Osten Sibiriens unterschiedet zwischen einer Handlung, die der Sprecher selbst gesehen oder miterlebt hat (direkte Erlebnisform), und einem z.B. Bericht über eine Handlung, die der Sprecher oder die Sprecherin nicht bezeugen kann, sondern worüber lediglich Informationen von Anderen erhalten wurden.
Die Vermutung auf Hörensagen erübrigt sich im Jukagirischen daher. Grammatische Mittel zum Ausdruck des Nicht-Selbst-Erlebens gibt es Haarmann zufolge hauptsächlich in Sibirien und Ostasien.
7. Pirahã – die seltsamste Sprache der Welt?
Pirahã ist eine vom gleichnamigen indigenen Volk im Amazonasgebiet Brasiliens gesprochene Sprache. Diese verfügt wie selten eine Sprache über eine hohe Dichte an Weirdheitsfaktoren, von denen einige auch umstritten sind. Die Linguistik erschütterte unter anderem die angebliche Abwesenheit der Rekursivität, welche ein zentrales Strukturmerkmal aller Sprachen sein soll. Was das genau bedeutet?
Das Pirahã kennt keine Möglichkeit zur Bildung hypotaktischer Strukturen. Heißt: bei der Rekursivität können Aussagen in andere Aussagen eingefügt werden. Zum Beispiel: Die Katze rennt. Die Katze, die aus dem Haus kommt, rennt. Die Fähigkeit einer Information eine weiter Information zuzufügen schien, laut Linguistik-Gott Noam Chomsky allen Sprachen inhärent und galt daher als universell. Bis… Ja, bis der Sprachwissenschaftler Daniel Everett 2005 mit der „Entdeckung“ dieses Pirahã-Twists für weltweite Aufregung sorgte.
Weitere Weirdo-Punkte des Pirahã wären:
- die Existenz von lediglich drei Zahlwörtern. hói „eins“; hoí „zwei“; baágiso „viele“ sowie keine grammatische Unterscheidung zwischen Singular und Plural. In neueren Quellen sagt Everett sogar, dass diese Zahlwörter fehlten und eine bessere Entsprechung dafür „wenige“ und „viele“ wären.
- Keine genuinen Farbbezeichnungen im eigentlichen Sinn („rot“, „schwarz“ usw.). Sprechende können Farben nur durch Verwendung anderer charakteristisch gefärbter Gegenstände bezeichnen (z. B. „wie Blut“, „wie Kohle“ usw.).
- Das einfachste bekannte System zum Ausdruck von Verwandtschaftsverhältnissen. Ein einziges Wort, baíxi (gesprochen [màíʔì]), bezeichnet sowohl Mutter als auch Vater. Die Pirahã scheinen Verwandtschaft nicht weiter als bis zu den biologischen Kindern zu verfolgen.
8. Die hundert Arten „ich“ zu sagen
Es gibt Sprachen, da ist es geradezu essenziell zu wissen, wie man sich selbst als ich ausdrückt. Warum? Weil manche Sprachen mehr als nur ein einziges Wort dafür haben. Eine davon ist das Khmer, die Sprache Kambodschas. Hier sind unter anderem Unterschiede im sozialen Status der Sprechenden und der Angeredeten zu beachten. Mit einem Mönch spricht das „ich“ anders als mit einer Frau. Hier einige Beispiele:
khnom – ich unterwürfig (in historischer Zeit gebraucht vom Haussklaven)
khnomkaruna – ich sehr höflich (insbesondere im Umgang mit Mönchen)
khnomba:t – ich (nur von Mönchen gebraucht)
khnommcah – Ich gegenüber sozial höher Stehenden (vorzugsweise von Frauen verwendet)
an – ich im familiären Sprachgebrauch (gebraucht von Älteren gegenüber Jüngeren)
khluen khnom – einfach nur ich (ohne spezielle soziale Markierung)
Interessanter Hinweis: Haarmann erklärt zur Khmer-Sprache: „Für Kambodschaner war nicht die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe entscheidend, die ihrerseits einen bestimmten Rang in der gesellschaftlichen Hierarchie einnahm, sondern seine eigene individuelle Positionierung gegenüber anderen Individuen.“
9. Aymara
Aymara gehört mit über 2 Millionen Sprechenden zu einer der heute am meisten gesprochenen indigenen Sprachen Südamerikas. Unter anderem gilt sie als offizielle Amtssprache in Bolivien und Peru. Warum diese Sprache auf unserer Liste der seltsamsten Sprachen der Welt ist? Weil sie einen mehr als interessanten Ansatz hat, mit den Phänomenen Vergangenheit und Zukunft zu verfahren.
In den meisten Sprachen ist die Zukunft etwas, das noch vor einem liegt und die Vergangenheit etwas, das, ja, vergangen und bereits hinter einem ist. So weit so gut. Doch Aymara dreht dieses Prinzip um und von Dingen in der Vergangenheit wird gesprochen, als würden sich die Sprechenden darauf zu bewegen und von der Zukunft redet man als etwas, das hinter einem liegt. Na dann: Zurück in die Zukunft.
10. Klick- und Schnalzlaute
Aus der Masse der rund 7.000 Sprachen weltweit tun sich einige davon durch ganz besondere („eigentümliche“) Laute hervor. Gemeint ist die Gruppe der Khoisan-Sprachen, die auch heute noch als „Schnalzsprachen“ (engl. Click languages) bekannt sind. Charakteristisch für diese Sprachgruppe sind Klicklaute und umfangreiche Phoneminventare (den Rekord mit 164 Phonemen hält ǃXóõ). Eine gute Erklärung einer dieser Sprachen findet ihr hier:
Titelbild Credits: Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Die Opfer der Beautyindustrie: Erblindung durch Hyaluronsäure?
Volle Lippen, gerade Nase und markante Wangenknochen – ganz ohne Operation? Hyaluron lautet das Zauberwort, wofür sich Menschen gar nicht […]
8 Ideen, wie du deinem Partner oder deiner Partnerin eine Freude bereiten kannst
Geben wir es ruhig zu: Beziehungen sind nicht immer leicht. Vor allem nach der anfänglichen Hochphase – sobald die Routine […]
500 Samenspenden: US-Boy fürchtet sich vor inzestuösem Date
Was für eine Geschichte. Zave aus Portland, Oregon, hat herausgefunden, dass sein Vater 500 Mal Sperma gespendet hat. Die Möglichkeit, […]
Prekrastination: Warum das Prekrastinieren dem Prokrastinieren um nichts nachsteht
In der Tat liest sich das Wort wie ein Tippfehler des Prokrastinierens. Doch im Gegensatz zu seinem Gegenpol, der die […]
WARDA WIRD’S WISSEN X SVEN VOTH
Er hat’s schon einmal vorgemacht – mit SNIPES. Jetzt legt Sven Voth mit HIGGINS nach. Neue Marke, gleiche Energie. Im […]
Kreative Ideen, um deinen Balkon fit für den Frühling zu machen
Die Tage werden wieder länger und die ersten Pflanzen sprießen aus der Erde, doch dein Balkon befindet sich noch im […]