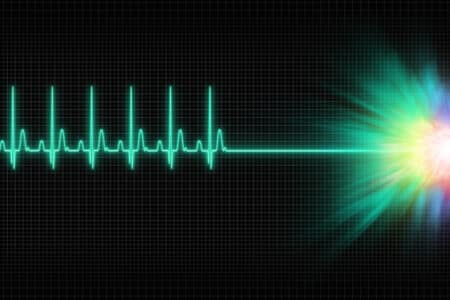„Du gehörst hier nicht her“, „Was denkst du eigentlich, wer du bist?“, „Du hast deinen Erfolg nicht verdient“ – wenn unsere Freunde so etwas zu uns sagen würden, würden wir die Freundschaft vielleicht noch einmal überdenken. Solche Aussagen sind eigentlich ein No-Go, dennoch Teil des täglichen inneren Monologs vieler Menschen. Menschen, die sich trotz ihrer Erfolge nie gut genug fühlen und diese hinterfragen, statt sie zu feiern. Menschen, die sich wie Hochstapler fühlen und Angst haben, dass jeden Moment jemand draufkommen könnte, dass alles was sie je erreicht haben (aus ihrer Sicht) unverdient war. Wir sprechen vom Hochstapler-Syndrom.
Wie kommt es zum Hochstapler-Syndrom?
Unter dem Hochstapler-Syndrom (auch: Impostor-Syndrom bzw. -Phänomen oder Impostorismus) versteht man zusammenfassend: Chronische Selbstzweifel in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten trotz widersprüchlicher externer Beweise. Vereinfacht gesagt: Menschen zweifeln an sich selbst und ihren Fähigkeiten, trotz diverser Erfolge.
Faktoren, die das Impostor-Syndrom verstärken oder in Gang setzen können, sind zum Beispiel: Hohe Raten des experimentellen Scheiterns (vor allem bei Entrepreneuren und Kunstschaffenden der Fall), administrative Ablehnung, die moderne Leistungsgesellschaft, der Mangel an Transparenz und Kommunikation über den mühsamen Weg zu professionellen Erfolgen.
Auslöser kann zum Beispiel das Gefühl sein, dass die Ausbilder:innen und Klassenkamerad:innen/Kolleg:innen einem selbst überlegen sind. Dies ist oft bei neu auszubildenden Personen der Fall.
Weiters kann das Impostor-Syndrom auch durch die Überforderung mit komplexen Lerninhalten oder Aufgabenstellungen ausgelöst werden. Das Problem hierbei ist, dass aufgrund der Natur des Syndroms die Minderwertigkeitsgefühle nicht im Verhältnis zur steigenden Erfahrung und den verzeichneten Erfolgen verblassen.

© Shutterstock
Der „Impostor cycle“: Ein Teufelskreis
Das Hochstapler-Syndrom hat selten akute Auswirkungen, vielmehr handelt es sich hier um chronische Manifestationen. Die Betroffenen sind in einem Teufelskreis gefangen, man spricht hier vom sogenannten „Impostor cycle“ (Hochstaplerzyklus).
Unter dem Hochstaplerzyklus versteht man folgenden Mechanismus, der bei Betroffenen in Gang gesetzt wird: Externen Faktoren wie Networking und harter Arbeit wird mehr zugeschrieben in Bezug auf die endgültige Leistung als den eigenen intrinsischen Fähigkeiten.
Ein Beispiel für das Hochstapler-Syndrom
Du erhältst ein Stipendium aufgrund eines Essays, welches du monatelang perfektioniert hast. Anstatt den Erfolg dir (deiner Idee, Kreativität und Schreibfähigkeit) zuzuschreiben, bist du überzeugt, dass es lediglich an den vielen Stunden lag, die du investiert hast. Das Ganze entwickelt sich dann zu einer Endlosschleife, da Betroffene Übervorbereitung mit dem Begriff Erfolg assoziieren.
Dieser Glaube kann bei Betroffenen zu Angstzuständen führen, wenn zum Beispiel die Zeit eine ausreichende Übervorbereitung nicht zulässt. Hinzu kommt noch die persönliche Überzeugung, dass es einem selbst an Fähigkeiten mangelt. Dieser Mangel muss mit extra Mühe und Arbeit kompensiert werden.
Natürlich spielen verschiedene Faktoren wie Networking und harte Arbeit eine Rolle, wenn es um Erfolg geht. Dennoch bringen diese Komponenten nichts, wenn man selbst keine Fähigkeiten aufweist. Diese angeborenen Fähigkeiten können durch diese externen Faktoren zwar gestärkt, aber niemals ersetzt werden.
Hochstapler-Syndrom: Ein weibliches Phänomen?
Anfangs nahmen Forscher an, dass das Hochstapler-Syndrom nur Frauen betraf. Eine der ersten Studien zu diesem Phänomen wurde 1978 von den Psychologinnen Dr. Pauline R. Clance und Suzanne A. Imes an der Georgia State University durchgeführt. Es kam zur Untersuchung von 150 Frauen aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Als Schlussfolgerung stellten Clance und Imes folgende Hypothese auf: Unter dem Hochstapler-Syndrom versteht man die Manifestation internalisierter gesellschaftlicher Erwartungen.
Frauen waren damals durchaus stärker von dem Impostor Syndrom betroffen. Dies lag vor allem daran, dass die Gesellschaft dem weiblichen Geschlecht in den 70er, 80ern und 90ern wesentlich weniger zuschrieb. Frauen wurden zu dieser Zeit als weniger kompetent im Vergleich zu Männern betrachtet.
Dies bezog sich vor allem auf das schulische und berufliche Leben. Doch auch heutzutage scheinen diese sexistischen und veralteten Muster noch durch. Zwar ist der geschlechterspezifische Lohnunterschied in Österreich zum Beispiel in den letzten Jahren zurückgegangen, dennoch verdienen Frauen auch heute noch deutlich weniger als Männer. Der Gender Pay Gap in der EU beträgt momentan 14,1 Prozent.
Dies kann zu einer kognitiven Dissonanz bei Frauen in Bezug auf ihre beruflichen Erfolge führen, da die Gesellschaft (durch die Gehaltsschere etc.) unbewusst Frauen die Message vermittelt, dass Männer kompetenter sind.
Dennoch ist das Impostor-Syndrom kein ausschließlich weibliches Phänomen.

© unsplash | Annie Spratt
Das Paradox des Impostor-Syndroms
Das Interessante an dem Hochstaplersyndrom ist die Tatsache, dass vor allem enorm erfolgreiche und leistungsstarke Menschen betroffen sind. Selbst Einstein sagte einmal: „Die übertriebene Wertschätzung meines Lebenswerkes beunruhigt mich sehr. Ich fühle mich gezwungen, mich für einen unfreiwilligen Betrüger zu halten.“
Studien zeigen, dass vor allem Akademiker stark unter dem Impostor-Syndrom leiden.
Eine weitere Gruppe, in der man dieses Phänomen besonders gut beobachten kann, sind Personen des öffentlichen Lebens. Meryl Streep spricht über Zweifel, die bei jedem neuen Projekt auf ein Neues hochkommen: „You think, why would anyone want to see me again in a movie? And I don`t know how to act anyway, so why am I doing this?“ (deutsch: Du denkst dir, warum würde mich jemand in einem Film wiedersehen wollen? Ich kann sowieso nicht schauspielern, also warum tue ich das?)
Auch Schauspieler Robert Pattinson leidet unter starken Selbstzweifeln. In einem Interview sagte er folgendes: „In a lot of ways I am quite proud that I`m still getting jobs. Because of falling into a job you always feel like youre a fraud, that youre going to be thrown out any second.“ (Anm. d. Red.: In vielerlei Hinsicht bin ich ziemlich stolz darauf, dass ich immer noch Jobs bekomme. Weil du in einen Job fällst, hast du immer das Gefühl, dass du ein Hochstapler bist, dass du jede Sekunde rausgeschmissen wirst.“)

Musiker Raf Camora sprach 2021 in einem Interview von seinen Erfahrungen mit dem Impostor-Syndrom: „Bei mir war das auf jeden Fall auch – dieses Hochstapler Syndrom. Du hast das Gefühl, du hast diesen Erfolg nicht selber verdient und du hast ihn nicht durch deine eigene Kraft erarbeitet, sondern alles ist einfach durch Zufall passiert.“
Behandlungsmöglichkeiten
Das Hochstapler-Syndrom ist nicht nur eine Haltung oder eine Meinung, die Betroffene über sich selbst haben. Es kann drastische Auswirkungen auf die eigenen Leistungen und die psychische Gesundheit von Betroffenen haben. Das Impostor-Syndrom wird oftmals mit Depressionen und Angstzuständen assoziiert.
Problematisch ist jedoch die Tatsache, dass dem Impostor-Syndrom noch keine medizinische Diagnose zugeschrieben wird. Es taucht noch nicht einmal im „American Psychiatric Asspciation Goldstandard Diagnostic“ oder im „Statistical Manual of Mental Disorders“ auf.
Die Psychologinnen Clance und Imes haben mithilfe ihrer Forschung aufzeigen können, dass eine kognitive Verhaltenstherapie und evidenzbasierte psychosoziale Interventionen bei Betroffenen zu positiven Ergebnissen führen können. Mit einer Kognitiven Verhaltenstherapie können pathologische Glaubenssysteme dekonstruiert und negative Verhaltensweisen abgebaut werden.
Beispiel einer therapeutischen Übung
Ein Rollenspiel kann Betroffenen beispielweise helfen: Betroffenen wird ein Preis oder eine Auszeichnung verliehen. Die Person, die den Preis überreicht, stellt dann klar, dass der Preis aufgrund der Leistung der betroffenen Person vergeben wurde. Dies kann so aussehen: „Ich habe dir den Preis nicht gegeben, weil ich dich nett oder charmant finde. Ich will dich für deine herausragende Leistung ehren.“ Sollte die betroffene Person widersprechen und noch immer der Meinung sein, sie habe den Preis nicht verdient, kann der Therapeut folgendermaßen reagieren: „Ich mag es nicht, wenn du mir widersprichst und meine Meinung negierst.“
Der Sinn der kognitiven Verhaltenstherapie ist es, die Sichtweisen der betroffenen Person in Bezug auf Feedback und die eigene Performance herauszufordern.
Weiters können auch Gruppenübungen beim Impostor-Syndrom sehr hilfreich sein, da diese einem aufzeigen können, dass die eignen Gefühle des inadequat Seins nicht im Einklang mit der Meinung der Außenwelt sind. Es ist wichtig für Betroffene zu sehen, dass ihre Mitmenschen ihr Selbstbildnis als Hochstapler nicht untermauern.
Was hilft Betroffenen im Alltag: Zwei wichtige Punkte
Die vorhin beschriebenen Übungen, welche in der Behandlung des Impostor-Syndroms angewandt werden, können in abgewandelter Form auch von Betroffenen in den eigenen Alltag integriert werden.
Wichtig ist es, die hochkommenden Selbstzweifel vorbeiziehen zu lassen, und nicht in ihnen zu verweilen. Wenn man sich überfordert fühlt, weil man nicht alles, was man sich vorgenommen hat, hinkriegt, muss man sich bewusst machen, dass die Gedankenspiralen und Minderwertigkeitsgefühle, in die man gerät, kontraproduktiv sind. Es ist besser die To-Dos abzuarbeiten, statt sich von der Angst und den Komplexen lähmen zu lassen.
Was hier helfen kann, ist das sogenannte „Tu etwas“-Prinzip. Dieses besagt, dass Motivation eine Folge von Aktion ist und nicht umgekehrt. Kurz gesagt: Anstatt auf Motivation zu warten, um mit einer Aufgabe anzufangen, sollte man einfach anfangen. Die Motivation folgt dann von selbst.
Die Harvard Universität versucht dem Hochstapler-Syndrom vorzubeugen, indem sie ihre Studenten auf der Uni Homepage über das Phänomen informiert und Tipps im Umgang mit den Selbstzweifeln gibt. Es wird betont, dass jeder Studierende seinen Platz an der Harvard Universität verdient hat. Weiters wird den Studenten abgeraten, sich mit anderen zu vergleichen.
Was wir als Gesellschaft tun können
Reden. Reden. Und noch mehr reden. Menschen teilen viel mit ihren Mitmenschen. Vor allem seit Instagram und Facebook wird gefühlt alles dokumentiert. Universitätsabschluss, Diplomprüfung, neuer Job, eigenes Unternehmen – Instagram ist voll davon. Was Menschen eher weniger posten sind ihre Misserfolge. In unserer Gesellschaft fehlt eine sogenannte „Failure“-Transparenz.
Kaum ein Unternehmer wird dir erzählen, dass er vier Mal fast bankrott gegangen ist. Oder, dass er trotz massiver Erfolge Angstzustände und Minderwertigkeitsgefühle hat. Alles womit wir tagtäglich bombardiert werden sind Erfolgsgeschichten, Businesszitaten und „perfekten“ Profilen.
Erfolg ist nicht linear und wir müssen langsam anfangen Gespräche über unsere Rückschläge und die nicht so schönen Seiten unserer Karrieren und Lebenswege zu führen. Denn diese toxische Wettbewerbsgesellschaft ist nicht nur unproduktiv, sondern erstickt auch noch den kollektiven Fortschritt. Da ein Umfeld entsteht, in dem Menschen Angst haben Fragen zu stellen und zu scheitern. Doch genau diese zwei Komponenten sind beides Voraussetzungen für Innovation.
In der Kultserie „Der Prinz aus Bel Air“ sagte Onkel Phil einmal folgendes zu Will: „Niemand macht etwas ohne Hilfe eines Anderen. Menschen öffnen mir Türen und ich öffne dir Türen. Es macht dich nicht weniger zum Mann, wenn du durch diese Türen gehst.“
Titelbild © Unsplash | Sir Manuel
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
April, April! Wie der Aprilscherz zur Tradition wurde
Jedes Jahr am 1. April herrscht Ausnahmezustand: Misstrauen liegt in der Luft, Arbeitskolleg:innen, Freund:innen und Familie lauern auf den perfekten […]
Ketamin, Kokain, Keks: Berliner Trends treffen auf Wiener Dekadenz
„Du bewegst dich lustig, worauf bist du bitte?“, erinnere ich mich noch an die Frage einer Freundin und an meine […]
Vorsicht: Snoozen schadet der Gesundheit!
Wer kennt sie nicht, die Snooze-Funktion am Smartphone. Viele morgendliche Aufwachroutinen kommen ohne gar nicht mehr aus. Wir stellen den […]
Verstärkt Geld den Egoismus?
Geld verdirbt den Charakter? Studienergebnisse untermauern den Spruch und zeigen, wie Geld unsere Gesellschaft spaltet!
Nahtoderfahrungen: Real oder doch nur Konstruktion des Gehirns?
Sind Nahtoderfahrungen real oder doch nur Fiktion? Wissenschaftler*innen haben sich dieser Frage gewidmet.
Wut positiv nutzen: wie positiver Umgang mit Wut das Leben verbessert
Das Gefühl Wut hat – man darf es ruhig so sagen – einen mehr als schlechten Ruf. Ausschreitungen. Morde. Prügeleien. […]