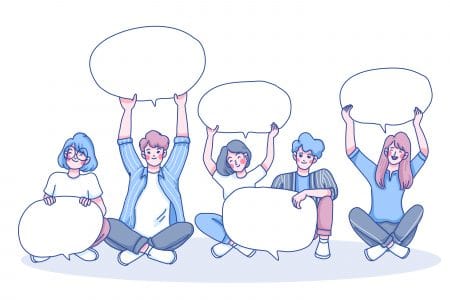Wie die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) vom Feminismus und der Pharmaindustrie kommerzialisiert wurde

Die mittlerweile „populär“ gewordene Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), mit der einst lediglich kriegstraumatisierte Soldaten diagnostiziert werden konnten, hat es in nur wenigen Jahrzehnten geschafft, auf immer mehr Vorkommnisse und Fälle ausgeweitet zu werden. Eine Entwicklung, die durchaus kritisch zu betrachten ist.
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) – Was ist das genau?
Die PTBS tritt bei Menschen auf, die im Krieg waren, etwas Schlimmes erlebt haben, lange einem Missbrauch zum Opfer fielen. Oder die Konfrontation mit einem Unfall oder dem plötzlichen Tod eines Familienmitglieds kann ebenso PTBS nach sich ziehen. So lautet zumindest die Definition der Alltagspsychologie.
Die PTBS ist eine schwere Form der Angststörung und tritt meist zeitlich verzögert auf (Post-traumatisch – also nach dem traumatisierenden Ereignis). Davon betroffene Menschen haben zuvor ein oder oft sogar mehrere schreckliche oder lebensbedrohliche Ereignisse erlebt, bei denen sie u.a. auch einen existenziellen Kontrollverlust erleiden mussten.
Was passiert bei einem traumatischen Ereignis?
Ein solches traumatisches Ereignis aktiviert unseren allzu menschlichen Kampf-oder-Flucht-Reflex im Gehirn und Körper. Zudem macht es die davon betroffenen Personen hyperwachsam, damit sich diese auch schützen können.
Klar, eine solche überdurchschnittlich Wachsamkeit ist bitter nötig, wenn man kämpfen oder fliehen will. Das Problem bei der PTBS ist jedoch, dass die darunter leidenden Personen sich ständig bedroht fühlen. Also auch noch, nachdem die Gefahr lange schon vorbei ist. Deren überhöhte Reaktion (bzw. Wachsamkeit) bleibt sozusagen konstant. Was natürlich unangenehme Symptome auslöst: Panikattacken, Flashbacks, Albträume, Vermeidung, soziales Isolieren, Wut, Schreckhaftigkeit, Schlaflosigkeit und Konzentrationsprobleme, um nur einige zu nennen.
© Unsplash | Kat J
Die Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln sich meist innerhalb eines Monats nach dem Vorfall. Können aber erst Monate oder Jahre später auftreten. Und bestehen länger als drei Monate. So zumindest die gängige Definition. PTBS kann zu gesundheitlichen Problemen oder zu exzessiven Alkohol- und Drogenmissbrauch führen.
Doch zuerst einmal heißt es: Beobachten und abwarten. Denn es ist wichtig zu wissen, ob die Symptome innerhalb der ersten drei Monate abklingen. Denn eine zu frühe und falsche Behandlung kann PTBS noch verschlimmern.
Die Posttraumatische Belastungsstörung und ihr Einfluss auf das Gehirn
Eine Posttraumatische Belastungsstörung ist, wie schon erwähnt, eine Form der Überlebensreaktion – Kampf oder Flucht. Das Gehirn ist dabei permanent unter Stress. Denn die anhaltenden Symptome der PTBS setzen ein, um weitere (befürchtete und überall vermutete) traumatische Erlebnisse überstehen zu können. Diese Reaktion führt zu einem erhöhten Stresshormonspiegel. Dieser Anstieg an Stresshormonen senkt die Aktivität des Hippocampus, was die Erinnerungsbildung erschwert.
Auch der Präfontale Cortex wird beeinträchtigt. Was Verhalten, Persönlichkeit und komplexe kognitive Funktionen (wie Planen und Entschieden) betrifft. Ebenso der Hypothalamus wird in Mitleidenschaft gezogen. Dieser setzt (unnötig) Adrenalin ins Blut frei, damit sich die Chancen zu überleben erhöhen. Dabei spielt es keine Rolle, dass nicht wirklich Gefahr besteht. Das Gehirn tut einfach so, als wäre das der Fall. Auf die Dauer ist das natürlich problematisch.
ABR: Die Akute Belastungsreaktion als kleine Schwester der PTBS
Auch eine Form der Belastungsstörung und ähnlich wie die PTBS ist die Akute Belastungsreaktion. Die Symptome sind dabei fast dieselben. Außer dass während der ABR Abgrenzung, Depression und Angst überwiegen. Während die Symptome der PTBS mit dem dauerhaften Kampf-und-Flucht-Mechanismus zusammenhängen.
Doch gilt die ABR als akut, weil diese schon wenige Stunden nach dem auslösenden Ereignis auftritt. Dabei aber meist nur einen Monat andauert. Bestehen die Symptome länger, kann sich daraus eine PTBS entwickeln. Doch hierbei gilt: Bei einer ABR kann schon das Gespräch mit Freundinnnen und Freunden dabei helfen, das Erlebte zu verstehen und in einen passenden Kontext einzubinden. Leider hört sich das alles besser an, als es tatsächlich ist, denn 80 Prozent der Betroffenen entwickeln nach einer ABR eine PTBS.
Die kulturelle Geschichte der PTBS
Erst im Jahr 1980 kam die Kategorie des Traumas von der American Psychiatric Association zu offizieller Anerkennung. Ausschlaggeben dafür war eine intensive Zuwendung zu den Vietnam-Veteranen.

„Während die kriegsmüde und in sich gespaltene Bevölkerung die Veteranen eher in ambivalenter Haltung empfing, bedeutete die PTSD-Diagnose eine Anerkennung und Würdigung ihrer psychologischen Leiden. Ihre verwirrenden Symptome und Verhaltensweisen wurden in greifbaren äußeren Ereignissen verankert, so daß die Hoffnung entstand, einzelne Veteranen vom Stigma der Geisteskrankheit befreien zu können und ihnen (theoretisch zumindest) Anteilnahme, medizinische Betreuung und Kompensation zu garantieren.“, so Mark S. Micale und Paul Lerner in ihrem Buch.1
Der therapeutische Diskurs – wie der Feminismus die PTBS als Taktik entdeckt
Dass im Verlauf ihrer Geschichte die PTBS später nicht nur bei Kriegstraumatisierten diagnostiziert werden konnte, lag vor allem an dem so genannten „therapeutischen Diskurs“. Vor allem im Feminismus sieht die Soziologin Eva Illouz eine der ausschlaggebendsten politischen und kulturellen Bewegungen, die den therapeutischen Diskurs übernommen haben. So versuchte der Feminismus mit dieser Psychologisierung des Alltags die repressiven Effekte des Patriarchats aufzudecken, um eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen.
Vor allem mit dem Blick auf das Phänomen des Kindesmissbrauchs entdeckte der Feminismus laut Illouz in der Therapie eine neue Taktik, um das Konzept Familie und das Patriarchat zu kritisieren. „Dies war (…) wohl deswegen der Fall, weil die Kategorie des „Kindesmißbrauchs“ den Feminismus in die Lage versetzte, kulturelle Kategorien – wie die des Kindes – zu mobilisieren, die mit besonders breiter Zustimmung rechnen konnten.“, so Illouz in ihrem grandiosem Buch Gefühle in Zeiten des Kapitalismus. Hervorzuheben sei hier vor allem Alice Miller („Das Drama des begabten Kindes“), die das Trauma ins Zentrum eines jeden Lebensnarratives platzierte.
Die Ausweitung der Posttraumatischen Belastungsstörung und die Milliardengewinne der Pharmaindustrie
Von da an war es nur noch ein kleiner Schritt Richtung Kommerzialisierung. Den Bereich, der als psychische Störung definierten Verhaltensweisen, weitete man somit immer mehr aus. So gilt mittlerweile schon vieles als Störung, was früher noch als normal gegolten hat. Illouz bringt eine ganze Liste an „Highlights“ des menschlichen Verhaltens, die mittlerweile als Störung definiert werden. Darunter zum Beispiel das „Trotzverhalten“, welches sich durch ein „Muster von ungehorsamen, negativistischem und provokativem Oppositionsverhalten gegenüber Autoritäten“ bemerkbar macht.
Weiteres hätten wir die „Histrionische Persönlichkeitsstörung“. Menschen mit dieser „Störung“ sind „lebhaft und dramatisch und ziehen immer alle Aufmerksamkeit auf sich“. Oder die „Hypersensitive Persönlichkeitsstörung“, in der die Betroffenen hypersensitiv gegen mögliche Zurückweisung, Demütigung oder Beschämung sind.
Fazit
Die Kategorie der psychischen Störungen wurde also immer mehr ausgeweitet und spielte schlussendlich vor allem den Pharmaunternehmen in die Hände, die natürlich darauf pochten, den Markt an psychischen und emotionalen Krankheiten anzuzapfen. Klar, umso mehr Menschen als Krank gelten, desto mehr Pillen kann man verkaufen. So werden auch psychische Krankheiten immer mehr zu einer schmalen Gratwanderung zwischen wirklichem Problem und instrumentalisiertem Kalkül einer erbarmungslosen Wirtschaftslogik.
1Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870–1930. Zit. nach: Eva Illouz (2012): Gefühle in Zeiten des Kapitalismus.
Titelbild © Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Deutschland-Klischees unter der Lupe: Von Autobahn bis Alkohol
Klischees über Deutschland? Wir verraten dir, wie es sich in Deutschland wirklich verhält – und wie du dich dementsprechend verhalten solltest.
Die richtige Auswahl von selbstblühenden Cannabissorten: Leitfaden für Einsteiger*innen
Als Neuling im Cannabis-Anbau kann die Sortenwahl anfangs überfordernd wirken. Besonders selbstblühende Cannabissorten, auch als Autoflowering-Cannabis bekannt, sind bei Einsteiger*innen beliebt. Doch […]
Herrenschuhe für Herbst und Winter – vier Alternativen zu Sneakern
Herbstoutfit: Männer neigen dazu, vor allem zu Sneakers zu greifen. Dabei gibt es viele stylishe Alternativen für den Herbst und Winter!
Netflix-Serien Tipp: Liebe und Anarchie – schwedische Dramedy, die Grenzen überschreitet
Zugegeben sind wir mit unserer Empfehlung vielleicht etwas spät dran, denn die erste Staffel der schwedischen Netflix-Serie Liebe und Anarchie […]
Gleichberechtigung #stattblumen - Fairness statt sexistischer Danksagungen
Die Coronakrise hat einige Schwachstellen aufgezeigt: Die wirtschaftliche Abhängigkeit von anderen Staaten, die begrenzten Kapazitäten des Gesundheitssystems und die schnelle Überforderung vieler Länder in Katastrophenfällen. Besonders offenkundig wurde, dass systemerhaltende Jobs in Bereichen wie z.B. im Handel und in der Pflege massiv unterbezahlt sind. Frauen sind hiervon besonders betroffen. Sie fordern jetzt Gleichberechtigung statt Blumen.
Fressefreiheit, Wichswichtel, Klötenkobold und Co: Was ist das beste Jugendwort des Jahres?
Jedes Jahr kührt eine unabhängige Jury das Jugendwort des Jahres. Letztes Jahr war es zum Beispiel das Wort „Cringe“. Auch […]