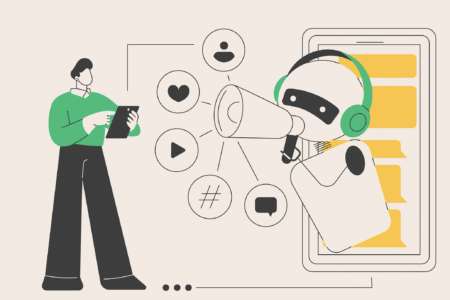Corona-Apps – Univ.-Prof. Dr. Coeckelbergh über Solutionism und gefährliche Langzeitfolgen

Corona-Apps sind in aller Munde und werden von vielen Regierungen befürwortet. Der Technikphilosoph Univ.-Prof. Dr. Mark Coeckelbergh von der Universität Wien betont, dass endlich mehr Diskussion darüber stattfinden müsse, wie technische Innovationen unsere Gesellschaft beeinflussen.
Eine Welt ohne Apps? Für die Generation Y kaum mehr vorstellbar. Egal, ob man den Titel eines Liedes herausfinden möchte, den schnellsten Weg zum nächstgelegenen Bankomat sucht oder Unterstützung bei der Partnerwahl braucht. Für all das bieten Applikationen wie Shazam, Google Maps oder Tinder den schnellsten Weg: mit ein paar Klicks ist man am Ziel. Doch nun soll uns eine neuartige App sogar bei der Bekämpfung einer Pandemie unterstützen.
Weltweit befinden sich sogenannte Contact-Tracing-Apps zur Bewältigung der Covid-19-Krise in der Testphase, oder stehen wie auch in Österreich bereits zum Download zu Verfügung. Nicht nur in Sachen Datenschutz werfen sie Fragen auf, die es zu diskutieren gilt. Für den Technikphilosophen Mark Coeckelbergh von der Universität Wien gilt: „Jede neue Technik geht auch mit neuen Problemen einher. In einer liberalen Gesellschaft müssen diese diskutiert werden und dürfen nicht unkritisch von der Regierung übernommen werden.“
IEEE: COVID crisis should not be pretext for violating fundamental rights https://t.co/3Tl9tUiY0D pic.twitter.com/ivK4P23nE8
— Mark Coeckelbergh (@MCoeckelbergh) April 17, 2020
Tracking App – die digitale Anti-Corona-Waffe
Die österreichische Variante der Tracking App nennt sich „Stopp Corona“ und wurde vom Roten Kreuz in Zusammenarbeit mit Accenture entwickelt. Das Prinzip dahinter scheint simpel: Anhand eines Tracking-Verfahrens und der Registrierung des „digitalen Handshakes“ soll sie ihre User darüber informieren, ob sie mit Infizierten in Kontakt gekommen sind. Via Bluetooth werden IDs zwischen den App-Nutzern ausgetauscht, die Information darüber geben sollen, ob ein Kontakt mit Infizierten erfolgt ist.
Diese Daten werden dezentral auf dem Gerät gespeichert und nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht. „Stopp Corona“ zählt bereits über 580.000 User, doch damit sie effektiv wirken kann, müsste sie von vierzig bis sechzig Prozent der Bevölkerung heruntergeladen werden – auf freiwilliger Basis. „Die Effizienz solcher Apps ist längst nicht bewiesen: Vielleicht helfen sie gar nicht, sind zu ungenau oder es ist bereits zu spät sie einzusetzen. Zudem produzieren sie natürlich andere Probleme in Sachen Privatsphäre.“, so Coeckelbergh.
Damit die „Stopp Corona“-App auch den Datenschutzrichtlinien entspricht, unterlief sie bereits einem Test der drei österreichischen Bürgerrechts- und Forschungsorganisationen Epicenter.works, Noyb und SBA Research. Das Fazit: Es gäbe keine kritischen Sicherheitslücken, in einigen Punkten jedoch Verbesserungsbedarf. Von den 26 Änderungsvorschlägen wurden 16 mithilfe einer Softwareaktualisierung – „Hotfix“ – umgehend bearbeitet. Die restlichen Punkte sollen innerhalb neuerer Versionen der App verbessert werden.
Die #ZIB1 hat heute über unsere Pressekonferenz zur „Stopp Corona“ App berichtet. Einige unserer Empfehlungen wurden bereits heute durch einen Hotfix umgesetzt – vor allem wird die Statistikfunktion entfernt. Hier zum Nachschauen: https://t.co/b2LEXlidEv
— epicenter.works (@epicenter_works) April 22, 2020
Das Phänomen des „solutionism“
Coeckelbergh erkennt in der Debatte um die Corona-Apps vor allem das Problem des „solutionism“: „Natürlich kann Technik unser Leben erleichtern und uns auch bei Problemen unterstützen. Der Glaube an die Technik als Heilsbringer birgt jedoch in vielen Bereichen Gefahren. Durch ihn gibt es zu wenig Interesse an politischen oder sozialen Bedingungen und Strukturen.“
Die wichtigeren Fragen innerhalb der Covid-19-Krise seien doch: Warum sind unsere Gesellschaften nicht auf eine solche Krise vorbereitet? Warum ist die medizinische Infrastruktur nicht gewappnet? Warum gibt es eine soziale Ungleichheit, die manche größeren Gefahren aussetzt als andere? „Das liegt sicherlich nicht daran, dass es zu wenig Technologien gibt. Dies sind soziale Probleme und daher sollte man diesen „technical solutionism“ auch skeptisch hinterfragen.“, so Coeckelbergh.
Auch in der Klimakrise spiele dieser eine große Rolle, denn das Geo Engineering nach dem Motto „Lass uns saubere Energie machen!“ bringe Problematiken mit sich, die nicht so leicht vorauszusehen sind. Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass im Umgang mit der Klimakrise neuartige Technik die Menschheit davor bewahren würde, fundamentale Dinge zu ändern: „Ich denke diese Mentalität kommt daher, dass es einen sehr unterschiedlichen Zugang zu Informationen gibt und das Interesse daran groß ist, uns nicht das Gefühl zu geben, wir müssten uns darüber Sorgen machen.“, erklärt Coeckelbergh.
(Tech-)Unternehmen, die an der Technik Gewinn machen, oder politische Interessen spielen dabei eine genau so große Rolle wie viele Menschen, die nichts an ihrem Lebensstil ändern können oder wollen. Daher brauche es laut Coeckelbergh gute politische Strategien, die Veränderungen in die richtige Richtung lenken. Der Philosoph plädiert für kompetente „Mediatoren“, die zwischen der Bevölkerung und Experten vermitteln und damit die demokratische Debatte anregen. Das Fehlen dieser zeige sich aktuell vor allem unter dem Trumpismus in den USA: rule without expertise.
„If solutionism is part of the problem, simply proposing solutions is not going to be the way to fix it“. #DavidRunciman.
— Juan Carlos Chirinos (@juance) May 19, 2020
Langzeit-Folgen
Coeckelbergh beschäftigt sich in seiner Forschung insbesondere mit den ethischen Aspekten der Digitalisierung und warnt auch in Bezug auf die Corona-Apps vor den Langzeitwirkungen solcher Innovationen: „Je mehr dieser Technologien nun verfügbar sind, desto größer wird die Versuchung seitens der Regierungen diese vermehrt einzusetzen. Sie haben nun gesehen, dass es möglich ist.“
Überwachungsfördernde Maßnahmen zerstörten außerdem das Vertrauen in die Gesellschaft: „Die Grundaussage der Regierung lautet ja: Wir trauen euch nicht zu eigenverantwortlich mit Problemen umzugehen und folgt damit einem klaren Top-down-Prinzip.“ Dies ermögliche es nun einigen Politikern, sich darüber zu profilieren, die Krise im Griff zu haben, wie beispielsweise Sebastian Kurz.
Außerdem zeigen Corona-Apps auf, dass wir bereits unter enormer Überwachung von Firmen wie Google und Microsoft standen, nur dass eine App hierorts nun erstmals politisch zum Zwecke der Überwachung genutzt werden soll. „Aus meiner Perspektive als Technikphilosoph ist es extrem wichtig, genau hierfür mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Technologien bringen ethische Probleme mit sich, die großflächig diskutiert werden müssen. Themen wie Künstliche Intelligenz sind keine marginalen Themen mehr, sondern mittlerweile extrem relevant auch für die Politik.“, betont Coeckelbergh.
From the recently released @UNESCO statement on COVID-19 (https://t.co/dJXBCZ0r3D) pic.twitter.com/i7QRLmaxaX
— Mark Coeckelbergh (@MCoeckelbergh) April 1, 2020
Die Frage nach der Datensicherheit
Die Frage nach dem Datenschutz spielt bei den Corona-Apps natürlich eine zentrale Rolle. Vergangene Woche veröffentlichte die EU Kommission Leitlinien für die Interoperabilität von Contact-Tracing-Apps zwischen den verschiedenen Ländern, die jedoch nicht in allen technischen Details ausgereift sind. Gemeinsame Prinzipien für alle Apps seien das Ziel, die Kontaktverfolgung solle freiwillig, transparent und zeitlich begrenzt sein. Zudem sollen die Verwendung anonymisierter Daten, wie auch die Cybersicherheit garantiert werden. In der Praxis agieren die Länder jedoch noch recht unterschiedlich. Die österreichische Corona-App gilt als Vorbild, da sie sich durch einen dezentralen Ansatz auszeichnet. Die Daten also nicht zentral gesammelt werden dürfen, womit man einer Instrumentalisierung derer entgegenwirken will. Im Gegensatz zu Polen und Frankreich, wo auf eine zentrale Datenspeicherung gesetzt wird.
Laut Coeckelbergh gäbe es tatsächlich einen Trend dahingehend, dass zu medizinischen Zwecken im Namen der Gesundheit fundamentale Rechte der Menschen missbraucht würden. Wenn dies zu einfach zugelassen werde, könnte das zu großen Problemen führen. Auf die Frage, wie sicher Daten überhaupt genutzt werden können, meint Coeckelbergh: „Mit dem Datenschutz ist es wie mit einem Regenschirm: Wenn der Wind kommt, ist er weg.“
Ohne Digitalisierung und die Corona-Apps grundsätzlich verteufeln zu wollen, gibt es für Coeckelbergh zu wenig Gründe, diese zu installieren, solange kein angemessener Dialog über alternative Strategien stattfindet. „Die Menschen haben natürlich Angst und wir sollten offen für alle Optionen sein, um die Dinge besser zu machen. Aber unsere Freiheitsrechte unhinterfragt aus dem Fenster zu werfen, bedeutet für mich definitiv einen falschen Schritt.“
Für Coeckelbergh zeigt die Krise insbesondere, dass Menschen innerhalb kürzester Zeit ihr Verhalten umstellen können und dass die Politik darin sehr wohl einen wichtigen Akteur darstellt. Wir sollten die Zeit nutzen, um demokratisch darüber zu verhandeln, wie eine Welt nach Corona aussehen sollte, denn die nächste Krise wird kommen und keine App ist allmächtig.
Interview aus dem Englischen übersetzt
Univ.-Prof. Dr. Mark Coeckelbergh. Professur für Medien- und Technikphilosophie an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft
Titelbild Credits: Martin Jordan
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Caritas und die Grenze der Nächstenliebe: Pflegekräfte müssen weiter warten
Ein flächendeckender Tarif hätte das Grundgehalt von deutschen Pflegekräften deutlich angehoben. Doch ausgerechnet der katholische Wohlfahrtsverband Caritas blockierte den Bescheid […]
Das Wort "Nein" - warum ich als Mann von Männern mächtig genervt bin
Es gibt einen Typus Mann, der es einfach nicht begreifen möchte. Einen, der es nicht in seinen kleinen, minderbemittelten, patriarchalen Dickschädel bekommt, was es mit dem Wort „Nein“ auf sich hat. Diese Sorte Mann kommt leider häufiger vor, als mir lieb ist, kostet Frauen viele Nerven, im Worst Case sogar die körperliche Unversehrtheit und versaut auch vielen Männern einige Abende.
The Idol: Lily-Rose Depp und The Weekend auf den Spuren von 50 Shades of Grey
Lily-Rose Depp und The Weekend haben die Hauptrollen in der HBO-Serie The Idol. Eine an sich gute Serie. Auch wenn […]
Stereotype und Sexismus in der Werbung - wenn falsche Rollenbilder prägen
Sexismus und Stereotypen waren und sind noch immer ein omnipräsentes Thema dieser Gesellschaft, egal ob für Männer oder Frauen – […]
Amazon: 1 Mrd. Steuergutschrift in Europa bei 50 Mrd. Umsatz
„Zum 31. Dezember 2021 hatten wir langfristige Schulden mit einem Nennwert von 50,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich des kurzfristigen Teils, hauptsächlich […]
Verstärkt Geld den Egoismus?
Geld verdirbt den Charakter? Studienergebnisse untermauern den Spruch und zeigen, wie Geld unsere Gesellschaft spaltet!