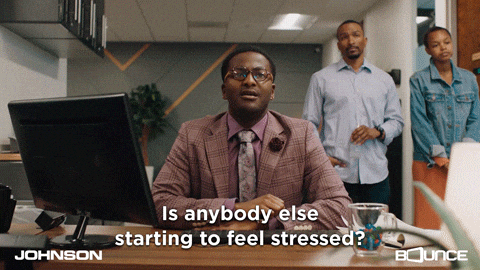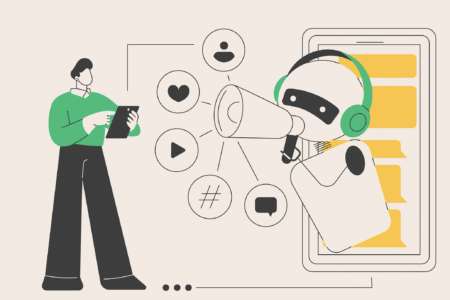Wer durch Social Media scrollt, bekommt schnell den Eindruck: Jeder Zweite hat ADHS, ist „neurodivergent“ oder „im Spektrum“. Manche finden sich durch Reels plötzlich in Checklisten wieder und denken: Das bin ja ich!
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) ist eine neurobiologische Störung, die sich unter anderem durch Unaufmerksamkeit, Impulsivität und innere Unruhe zeigt. Bei Autismus (bzw. Autismus-Spektrum-Störung, kurz ASS) geht es zum Beispiel um Reizüberflutung, soziale Schwierigkeiten und besondere Denkmuster. Beide Diagnosen sind komplex, individuell und medizinisch ernst zu nehmen.
Was aber oft übersehen wird: Die echte Diagnose ist kein Online-Quiz. Sie erfolgt durch Fachleute: Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen, spezialisierte Kliniken. Dabei werden Anamnesegespräche, standardisierte Tests, Verhaltensbeobachtungen und oft auch Fremdanamnesen durchgeführt. Es braucht Zeit und Erfahrung.
Diagnose ist kein DIY-Projekt
Klar, es ist menschlich, sich in Symptombeschreibungen wiederzufinden. Wer ständig müde, überfordert oder abgelenkt ist, fragt sich schnell: Hab ich auch ADHS? Aber nicht jede Zerstreutheit ist eine Diagnose. Manchmal steckt dahinter Schlafmangel. Oder Dauerstress. Oder schlicht ein Leben ohne Pausenknopf. Wer sich vorschnell selbst ein Label verpasst, läuft Gefahr, andere Ursachen zu übersehen oder sich auf eine Erklärung zu fixieren, die gar nicht zutrifft. Das hilft auf Dauer niemandem. Vor allem nicht der eigenen Gesundheit.
Hilfe statt Label?
Es ist nachvollziehbar, dass viele erleichtert sind, wenn sie eine Erklärung für jahrelange Überforderung, emotionale Erschöpfung oder das Gefühl des „Andersseins“ finden. Eine Diagnose kann helfen, sich selbst besser zu verstehen und gezielt Hilfe zu bekommen.
Was hilft tatsächlich bei ADHS? Vieles, aber es muss individuell passen. Therapie spielt oft eine zentrale Rolle – vor allem Verhaltenstherapie, bei der Strategien zur besseren Selbstorganisation, Reizfilterung und Impulskontrolle entwickelt werden. In schweren Fällen helfen Medikamente wie Ritalin, die die Reizverarbeitung im Gehirn unterstützen. Ergänzend kommen Coaching, Strukturhilfen wie Apps oder To-do-Listen und oft auch Bewegung, Achtsamkeit oder gezielte Entspannungsübungen zum Einsatz. Wichtig ist: Es geht nicht darum, Symptome „wegzumachen“, sondern besser mit ihnen zu leben.
Schluss mit der Romantisierung
Ein weiterer kritischer Punkt: Auf Social Media werden psychische Erkrankungen manchmal ästhetisiert. Reels mit traurigem Indie-Sound, träumerischem Blick aus dem Fenster, darunter: „My neurodivergent brain“. Aber Depression ist nicht poetisch. Autismus ist nicht nur „quirky“. ADHS ist nicht süß-chaotisch, sondern kann den Alltag massiv erschweren. Solche Darstellungen – auch wenn gut gemeint – verzerren die Realität. Und sie können bei echten Betroffenen ein ungutes Gefühl hinterlassen: Warum wirkt meine Erkrankung nicht so „schön traurig“ wie bei den anderen?
Der Umgang im echten Leben
Wer mit einer echten Diagnose lebt, hat oft Jahre gebraucht, um sich zu organisieren, mit Symptomen umzugehen, Therapieplätze zu finden. Umso frustrierender, wenn andere beiläufig sagen: „Sorry, hab’s vergessen, ADHS halt.“ Eine Diagnose ist keine Freikarte für alles. Natürlich darf man offen sein. Natürlich darf man um Verständnis bitten. Aber wer eine Erkrankung – ob vermutet oder echt – zur permanenten Entschuldigung macht, riskiert, dass echtes Verständnis schwindet. Im Berufsleben, im Freundeskreis, überall dort, wo man auch mal Verantwortung übernehmen muss. Trotz innerem Chaos.
Mehr Empathie, bitte
Vielleicht geht es am Ende gar nicht darum, ob jemand wirklich ADHS hat oder einfach chronisch gestresst ist. Sondern darum, sich selbst und andere ernst zu nehmen, mit allem, was gerade schwerfällt. Nicht alles muss gleich eine Diagnose sein. Aber vieles verdient mehr Verständnis und manchmal auch ein ehrlich gemeintes: „Wie geht’s dir wirklich?“ Empathie heißt nicht, alles hinnehmen zu müssen. Empathie heißt zuhören statt urteilen und sich trotzdem trauen, Grenzen zu ziehen.
Do’s und Don’ts bei mentaler Gesundheit
Wir müssen lernen, die psychische Gesundheit nicht als Trend zu behandeln, sondern als Teil unserer Realität.
Do’s:
- Hol dir professionelle Hilfe, wenn du dich überfordert fühlst
- Sprich offen, aber reflektiert
- Nimm deine eigene Wahrnehmung ernst, aber prüf sie auch kritisch
Don’ts:
- Nimm Social-Media-Checklisten als Ersatz für Diagnostik
- Verwende Diagnosen nicht als Ausrede für respektloses Verhalten
- Mach psychische Erkrankungen nicht zu deinem Hauptmerkmal
Denn echte mentale Gesundheit beginnt nicht mit einem Post, sondern mit dem ehrlichen Blick nach innen.
Titelbild © Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
The Idol: Lily-Rose Depp und The Weekend auf den Spuren von 50 Shades of Grey
Lily-Rose Depp und The Weekend haben die Hauptrollen in der HBO-Serie The Idol. Eine an sich gute Serie. Auch wenn […]
Österreichs "Jahrhundertunwetter" der letzten Jahre
Anstatt nur alle 100 Jahre, führt uns beinahe jährlich ein sogenanntes "Jahrhundertunwetter" heim. Wir haben den Überblick.
Der Wiener Akademikerball: Tradition oder politische Provokation?
Der von der FPÖ organisierte Wiener Akademikerball (auch „WKR-Ball“) findet seit 2013 jährlich in der Wiener Hofburg statt. Während er […]
Jordan Peterson, gefährlicher Demagoge oder harmloser Gaukler?
Jordan Peterson gilt als einer der reichweitenstärksten Prediger für konservative Werte. Doch wie gefährlich sind seine Thesen wirklich?
Bildungssystem Österreich: Wo sinnlos Geld verbrannt wird
Österreich hat das zweitteuerste Bildungssystem in ganz Europa. Nach jedem PISA-Test dümpelt das Land dennoch durch einen Sumpf der Durchschnittlichkeit […]
Querdenkerin-Vergleich mit Sophie Scholl - Ordner reagiert: "So ein Schwachsinn!"
Bei den Querdenker-Demonstrationen kommt es – wie solls auch anders sein – immer wieder zu heftigen Ausrutschern. Während sich die […]