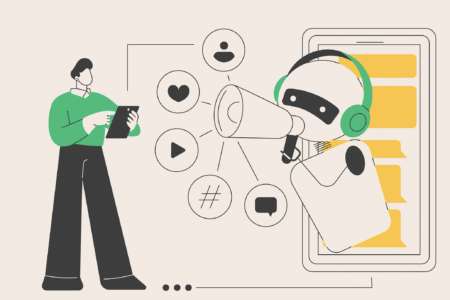In regelmäßigen Abständen überraschen uns die Pharmafirmen mit immer „neueren“ und „innovativeren“ Arzneimitteln. Doch eine bessere Wirkung bleibt aus. Lange schon geht es nicht mehr um die Entwicklung neuer Medizin, sondern darum, mit ein und demselben Rezept so lange wie möglich viel Geld zu verdienen. Es verwundert nicht, dass daher mehr Geld in Marketing als in die Entwicklung neuer Medikamente fließt.
Die goldene Regel
Gerade in Zeiten der Impfstoffdebatte hat man den Eindruck, dass nicht mehr das beste Produkt „gewinnt“, sondern jenes, dass die bessere Marketingschiene fährt. Dasselbe gilt auch lange schon im kulturellen Bereich. Bei Film, Musik und Literatur zum Beispiel. Das qualitativ Beste findet sich nie wirklich oben auf den Bestseller-Listen.
On the Top tummeln sich hauptsächlich jene Werke (bzw. Produkte) bei deren Erscheinen entsprechend viel ins Marketing investiert wurde. Daher ist es nicht wirklich verwunderlich, dass auch die Pharmabranche mehr Geld fürs Marketing ausgibt, als für die Forschung und Entwicklung neuer Arzneimittel. Ganz nach der berühmten Regel: „Je weniger man ein Produkt braucht, desto mehr Marketing braucht das Produkt.“
Kaum noch neue Medikamente
Die Pharmaindustrie steht vor einem Problem. Sie wird zunehmend innovationsunfähiger. Zwischen 1990 und 2005 kamen weltweit um die 460 „neue“ Wirkstoffe auf den Markt. Davon waren „nur sieben echte Durchbrüche im Sinne neuer Behandlungsmöglichkeiten in der Breitenmedizin“, so der Pharmakologe Peter Schönhöfer. 90 Prozent dieser „neuen“ Wirkstoffe waren sogar reine „Scheininnovationen, die zwar die Therapie verteuern, aber nicht verbessern oder bereichern“. Obwohl, bereichern tun sie schon. Und zwar die Industrie.
Unter dem Begriff „Scheininnovation“ verstehen Kritiker und Kritikerinnen all jene Medikamente, die eine Neuerung auf einem Gebiet nur vorgaukeln. Im Grunde jedoch nur mehr von the same old shit sind. Der Klassiker unter diesen „Innovationen“ ist die Nachahmung von Wirkstoffen bereits zugelassener Arzneimittel. Der tatsächliche Unterschied zu dem schon existierenden Mittel liegt meist in „einem kleinen molekularen Detail oder in der chemischen Struktur“. Was im Prinzip nicht relevant ist, aber auf dem Papier ein „neues“ Produkt verspricht. That’s it! Und das ist so viel wie gar nichts. Das ist etwas „Neues“ auf dem Papier, einem Papier, dass nicht die Tinte Wert ist, mit der es bedruckt wird.
Das ist so als on man bei einem Werk von Shakespeare ein Komma versetzt und behauptet, es wäre etwas Neues. Doch es funktioniert. In der Kunst schon länger. Warum dann auch nicht bei Arzneimitteln? Und das tut es auch.
Wichtig ist dabei lediglich das Marketing. Denn Fakt ist, es werden kaum noch (wirklich) neue Medikamente hergestellt. Stattdessen werden schon bekannte und sich gut verkaufende Produkte „modifiziert“, sobald deren Patent einmal abgelaufen ist. So forciert man die Vermarktung. Man verkauft immer nur dasselbe unter dem Logo des Neuen.
„Neuer“ Stoff, gleiche Wirkung
Im Kunst- und Kulturbereich spricht man von „Selbstplagiat“. In der Arzneimittelbranche wird jedoch gleich ein neuer Patentschutz beantragt. Und man bekommt diesen problemlos. Auch wenn der „neue“ Wirkstoff (mit dem sinnlos-neuem Molekül) keine Verbesserung im Vergleich mit dem schon existenten bringt.
Ein konkretes Beispiel dafür, dass das funktioniert, sind die Präparate Nexium und Antra. Zwei Mittel gegen Magengeschwüre. Oder nur ein einziges? Astra Zeneca brachte 1989 „Antra“ auf den Markt. Ein Bestseller! Als die Patente dafür abzulaufen drohten und günstigere Generika dem Bestseller den Rang abzulaufen drohten (Heißt: massive Gewinneinbrüche!), war man gezwungen zu reagieren.
Mit einem neuen Arzneimittel? Nein! Man half sich mit einem (billigen) Trick. Astra Zeneca entfernte einen Teil des Wirkstoff-Moleküls von „Antra“ und brachte „das Ganze“ als neues Medikament auf den Markt. „Nexium“, war geboren. Patentiert hat man „das Neue“ natürlich auch.
Fazit: „Man hat im Prinzip keinen neuen Wirkstoff. Astra Zeneca hat einfach die Hälfte des alten Wirkstoffs genommen und als neues Arzneimittel vermarktet. Insofern ist der neue Wirkstoff von „Nexium“ eine Scheininnovation.“, bestätigte Gerd Glaeske, Autor des deutschen Arzneimittelreports und Professor für Arzneimittel Versorgung an der Uni Bremen.
Solche minimalen strukturellen Veränderungen sind nicht ausschließlich Betrug. Diese subtilen Modifikationen können durchaus einen Unterschied ausmachen. Vor allem bezüglich dem Metabolismus, bei der Aufnahme des Stoffs im Verdauungstrakt. Doch für Experten ist klar, dass Pharmafirmen diese Verfahren missbrauchen, um ihre Umsätze zu steigern. Dies gelingt mit einer entsprechenden Marketingkampagne, die die Verbesserung einer alten Rezeptur verspricht. Bekannt vor allem aus dem Lebensmittelmarkt.
Das Marketing der Pharmaindustrie
Viele wundern sich. Das ist nachvollziehbar. Medikamente sollen sich doch verkaufen, weil sie wirken. Weil Experten im Warentest wissenschaftlich erkannt haben, dass diese Medikamente gut sind. Werbung scheint da doch nicht nötig, man bekommt es schließlich vom Arzt oder der Ärztin verschrieben.
Doch die Zahlen erzählen eine andere Geschichte. Hier fließt mehr Geld ins Marketing als in die Forschung. Es werden generell viel mehr Ressourcen investiert, ein Medikament gut aussehen zu lassen, als seine pharmakologischen Eigenschaften zu verbessern.
Marketing Based Medicine
Die Pharmaindustrie geht bei ihren Bemühungen, die Umsätze zu steigern, oft besonders diabolisch vor. Sie macht nicht einmal halt davor, ehrliche Wissenschaft zu pervertieren.
„Marketing Based Medicine“ nennt sich dieser schäbige Ansatz. Eine Abwandlung der „Evidence Based Medicine“, in der es darum geht, in gewissenhaften Studien, in Erfahrung zu bringen, ob ein Medikament einen wirklichen Nutzen hat. Aber das war einmal. Evidence hat lange schon dem Marketing Platz gemacht. Doch wie funktioniert diese Marketing Based Medicine genau?
Strategien
Vor allem, da direkte Werbung verboten ist, müssen Hersteller zu ganz besonderen Tricks greifen, um den Umsatz zu steigern. Daher investieren sie ins Marketing. Eine recht beliebte Strategie: dasselbe Produkt in seiner Form zu verändern. Man bietet z.B. eine Tablette einfach in Form eines Gels an. Auch zeigt sich ein Perspektivenwechsel oft als sehr hilfreich. Aspirin wird so nicht nur zu Linderung von Kopfschmerzen angepriesen, sondern soll „auch das Wohlbefinden steigern und die Symptome einer Grippe abschwächen.“
Die Zusammenarbeit mit PR-Agenturen ist daher für Pharmafirmen keine Seltenheit. Auch mit Ärztinnen und Ärzten, sowie mit Selbsthilfegruppen wird kooperiert. Schulungen und Konferenzen sollen die Aufmerksam für das Medikament steigern. Und zwar nicht beim Otto-Normal-Verbraucher, sondern bei den Opinion Leaders, den MedizinerInnen, die ein bestimmtes Produkt bevorzugen sollen.
So ist die Suche nach Meinungsführenden essenziell. Das sind Wissenschaftler und Ärzte, die in Fachkreisen hoch angesehen sind. Bezahlte Meinungsbildung durch Steuerung der Meinungsführer, lautet die Devise. Das Medikament wird in ihren Vorträgen, auf (oft selbstorganisierten) Konferenzen und in Artikeln erwähnt. So wird die Aufmerksamkeit in den Fachkreisen und in der Öffentlichkeit gestärkt. Auch vor selbstfinanzierten Studien macht die Pharmaindustrie nicht halt.
Kritik auch von Krankenkassen
Der Arzneimittelmarkt als Goldgrube. Kritik an diesen Verfahren hagelt es natürlich von allen Seiten. Aus dem Feld der unabhängigen Forschung sowie auch von den Krankenkassen. Letztere müssen schließlich immer teurere Medikamente „abgelten“, deren Vorteil im Endeffekt nicht einmal wirklich gegeben ist. Ob die Gesellschaft sich das leisten soll?
Vor allem: Warum leistet sie sich nicht eine wirkungsvolle Entwicklung der Arzneien? Die Pharmaindustrie. Wieder einmal ein Bereich, der seine Forschungsabteilung vielleicht lieber an die Herausforderungen unserer Zeit anpassen sollte. Doch fokussiert man sich dort lieber auf den einfachen Weg Geld zu verdienen. Aber wer weiß, vielleicht ist ja genau das die Herausforderung unserer Zeit. Viel Geld verdienen mit wenig Aufwand. Die Gesundheit der Menschen: nur eine positive Nebenwirkung.
Titelbild Credits: Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Blutbuch – Kim de l'Horizons fulminantes, non-binäres Romandebüt
Mit Kim de l'Horizons Debütroman Blutbuch (erschienen bei DuMont) ist seit langem und endlich, endlich, muss man sagen, nein, endlich, muss man schreien! ein Text erschienen, der literarisch geradezu meisterhaft ein Phänomen einzufangen vermag, mit dem sich viele Literaturschaffende schwertun.
Reich, aber kein Geld: Twitter-Kauf von Elon Musk zeigt, wie Steuern vermieden werden
Wie absurd unser Finanzsystem zum Teil ist, dürfte wohl jedem klardenkenden Menschen bekannt sein. Trevor Noah hingegen geht in „The […]
Psychopathen in Führungspositionen: Ein Spiegel des erkrankten Systems
In der heutigen Leistungsgesellschaft muss der Mensch immer funktionieren, um jeden Preis. Psychopathen und Menschen mit psychopathischen Zügen eignen sich […]
Der Gedichtband Atemprotokolle: Aleš Štegers Trip ins Innere
Der Gedichtband Atemprotokolle von Aleš Šteger ist eine Art Zen-buddhistisch-lyrischer Rausch, den man unbedingt miterleben sollte.
Must-See-ARTE-Doku: "Eine Geschichte des Antisemitismus"
Von den Wurzeln des Phänomens Antisemitismus hin zur heutigen Zeit, wo trotz der Holocaust-Gräueltaten die Judenfeindlichkeit nach wie vor viele […]
Die fünf E des Narzissmus – nach Reinhard Haller
Eine narzisstische Störung kann, laut Reinhard Haller, in fünf entlarvende Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen eingeordnet werden.