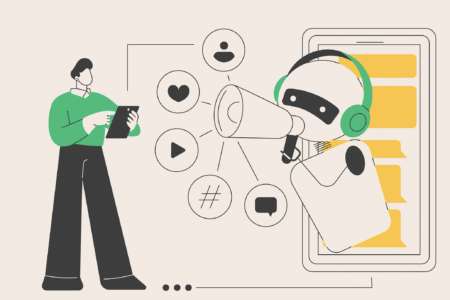Nichts lieben die Deutschen und die Österreicher*innen mehr als ihre Würste. Doch gerade dieses kulinarisch heiß begehrte Objekt der Begierde läuft Gefahr von einer unsichtbaren Schattseite heimgesucht zu werden, dem Separatorenfleisch. Anstatt qualitativ hochwertigem Fleisch landet nämlich oft eine Form des Fleischabfalls in den Würsten.
König Wurst und die dunkle Seite
Im Jahr 2020 haben die Deutschen im Durchschnitt 27 Kilogramm Wurst pro Kopf konsumiert. Das macht ca. 75 g pro Tag. In Österreich ist dasselbe Produkt nicht weniger beliebt. Fleischgerichte kommen hierzulande bei 43,6 Prozent der 15- bis 29-jährigen Österreicher*innen mehrmals pro Tag auf den Tisch. Ein Drittel dieser Altersgruppe isst Fleisch mehrmals pro Woche. 44 Prozent der Männer konsumieren täglich Fleisch oder Wurst, bei Frauen ist der Anteil um die Hälfte kleiner (22 Prozent). Diese Zahlen sind beachtlich.
Doch wie das eben so ist, läuft jeder Konsumschlager über kurz oder lang Gefahr missbraucht zu werden. Denn immer mehr ungustiöse Fleischreste landen in den Supermarktwürsten. Sogenanntes Separatorenfleisch.
Separatorenfleisch, was ist das?
Egal wie gut der Metzger oder die Metzgerin auch immer ist, bei der Verarbeitung des Tieres wird es unweigerlich zu Fleischresten kommen. Oftmals kleine Stücke am Knochen, die mit dem Messer nicht mehr gut abgelöst werden können.
Doch die Fleischindustrie wirft in diesem Fall natürlich nichts einfach so weg, was man noch irgendwie verwenden könnte – im Vergleich zu anderen industriellen Zweigen geradezu vorbildhaft, möchte man meinen. Daher werden die Reste, mit ein wenig Fleisch noch dran gesammelt und durchlaufen einen durchaus spannenden Prozess der Wiedergeburt.
Schlachtabfälle und Reste werden unter Hochdruck durch Siebe oder Lochscheiben gedrückt und so von den Knochen getrennt. Also separiert! Dabei entsteht ein preisgünstiger Fleischbrei. Im Grunde werden die Reste in einen Schredder geworfen, der mit Gewalt die Knochen total zermalmt und über einen Druckzylinder alle weichen Anteile abpresst und zu einer Masse zuführt, die man Separatorenfleisch nennt. Ein minderwertiges Produkt ist.
Kennzeichnungspflichtig und verboten
Man verwendet es natürlich trotzdem in diversen Fleischprodukten. Weil das Image davon jedoch alles andere als vorteilhaft ist, lassen die deutschen Hersteller die Kennzeichnung des Separatorenfleisches einfach weg. Laut Gesetz (Deutschland) muss Separatorenfleisch auf der Verpackung aber angegeben werden, da es kennzeichnungspflichtig ist.
Der österreichische Lebensmittelcodex bildet die Basis für die Handhabung von Separatorenfleisch hierzulande. Die Anforderungen des AMA-Gütesiegelprogramms gehen dabei noch weit darüber hinaus. Beispielsweise dürfen Würste mit dem AMA-Gütesiegel weder Mehl noch Stärke enthalten. Auch technologisch wirkende Stoffe zur Wasserbindung, wie Carrageen oder Johannesbrotkernmehl, sind verboten. Weiters sind Herzmuskulatur und Separatorenfleisch tabu.
Separatorenfleisch nur schwer nachweisbar
Das Problem mit dem Separatorenfleisch ist jetzt aber, dass es nur schwer nachzuweisen ist. Suchte man vor kurzem noch nach dem Knochenmaterial und konnte so die Herstellenden überführen, wird das Separatorenfleisch mittlerweile so fein hergestellt, dass Knochenanteile nur noch sehr schwer bis gar nicht zu finden sind.
Kalziumanteile (auch eine Methode zu Überführung) kann man „einstellen“, man extrahiert oder verdünnt diese einfach mit anderen Zusätzen. Bedeutet: Es fehlt die Methode, Separatorenfleisch zu finden. Daher sind die Wurstherstellenden den Kontrolleuren um einen Schritt voraus. Die Separatoren vor 20 Jahren haben noch „hart gearbeitet“ und hatten einen stärkeren Knochenabrieb, doch mittlerweile hat sich die Technik verfeinert und Knochenreste sind, wie schon erwähnt, nur noch schwer nachzuweisen.
Die neue Lösung
Die Wissenschaftler*innen, angeführt vom Bremerhavener Hochschulprofessor Stefan Wittke, haben seit kurzem jedoch ein neues Verfahren entwickelt. Nicht mehr nach Knochenpartikel, sondern nach einem bestimmten Eiweiß, von dem man weiß, dass es sich nur in der Bandscheibe und im Knorpel findet, wird gesucht. Eine Art „Fingerabdruck für Separatorenfleisch“.
In Deutschland gibt es keine konkreten Zahlen zum Separatorenfleisch, obwohl dieses natürlich problemlos gekauft werden kann, da es nicht verboten, sondern nur kennzeichnungspflichtig ist. Dennoch gibt es keine Zahlen darüber, wie viel davon produziert wird bzw. verkauft wird, da es als Zusatz natürlich extrem unbeliebt ist.
Über Monate kauften NDR und Spiegel Geflügelwurst in den Supermärkten Deutschlands und ließen diese mit der neuen Verfahrenstechnik überprüfen. Ergebnis: von 30 Proben fielen 9 Proben positiv aus. Bedeutet: fast jede dritte Probe wurde positiv auf Separatorenfleisch getestet. Aber nur mithilfe des neuen Verfahrens, das nach Eiweiß sucht und nicht nach Knochen. Sogar bei Würsten namhafter Herstellender konnte die unliebsame Fleischform nachgewiesen werden.
Industriell veränderte Wurst
Wurst ist für den unmündig Konsumierenden – also für den Großteil von uns – ein Konglomerat an Dingen, die wir nicht kennen und von denen wir glauben müssen, dass sie lecker und gut sind. Unabhängig von dem Geschmack ist es jedoch Tatsache, dass einige deutsche Wurstproduzierende ihre Würste mit Separatorenfleisch strecken, um damit natürlich viel mehr Gewinn zu erwirtschaften. Im Vergleich zum normalen Fleisch ist das Separatorenfleisch natürlich um einiges billiger.
Ist Separatorenfleisch gesundheitsschädlich?
Grundsätzlich ist Separatorenfleisch nicht gesundheitsschädlich. Die Europäische Union hat hierfür sogar strenge Vorschriften eingeführt: Betriebe dürfen keine Überreste von Rindern, Schafen und Ziegen verwenden, um Separatorenfleisch herzustellen. Ebenso dürfen importierte Fleischprodukte kein Separatorenfleisch dieser Tiere enthalten.
Dies hat seinen Ursprung in der Tatsache, dass Gehirn und Rückenmark dieser Tiere Krankheitserreger, sogenannte Prionen, enthalten können, die beim Menschen Gehirnerkrankungen wie die Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE) auslösen können.
Da Separatorenfleisch stark zerkleinert ist, steigt das Risiko für mikrobielle Verunreinigungen. Vereinfacht ausgedrückt, bietet dies Erregern eine größere Angriffsfläche. Gesundheitliche Risiken entstehen jedoch nur dann, wenn die Betriebe die Hygiene- und Temperaturrichtlinien für die weitere Verarbeitung der Fleischreste nicht korrekt einhalten. Die Herstellung von Separatorenfleisch muss unter anderem unmittelbar nach dem Entbeinen der Tiere erfolgen.
In Zukunft mit Separatorenfleisch?
Auch wenn dies vermutlich niemand hören will: Die Nutzung von Separatorenfleisch hat durchaus auch einige Vorteile: Es müssen weniger Tiere gehalten werden, weil größere Fleischmengen aus den einzelnen Tieren gewonnen werden. Dadurch fällt unter anderem weniger Gülle an, die bei intensiver Tierhaltung bereits jetzt eine enorme Umweltbelastung darstellt. Auch der Bedarf an Tierfutter ist dadurch geringer. Wie sich die Verwendung von Separatorenfleisch in Zukunft entwickelt, bleibt jedoch abzuwarten.
Bilder © Shutterstock
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Infinite Money Glitch: TikTok-Trend ist Scheckbetrug
Infinite Money Glitch: TikToker nutzen vermeintliche "Fehlfunktion" im Bankensystem, der angeblich unbegrenzt Geld freisetzen kann.
Gibt es die ewige Liebe? Soziologin Eva Illouz klärt auf
Gibt es die ewige Liebe? Soziologin Eva Illouz klärt auf. Über Langzeitbeziehungen, Machtverhältnisse und fehlenden Fortschritt.
Streamerinnen für pornografische Deepfakes missbraucht
Streamerinnen werden für pornografische Deepfakes missbraucht. Große Twitch Streamerinnen wie QTCinderella und Maya Higa zählen zu den Opfern.
Nach EM-Finale und Fans-Eklat: Hat Fußball ein Rassismus-Problem?
Nachdem drei schwarze Spieler die Elfmeter für England verschossen hatten und England das EM-Finale verlor, ging auf Twitter eine rassistische […]
Black Friday: Was du über den Shopping-Wahnsinn wissen solltest
Black Friday steht vor der Tür. Doch was wirklich hinter diesen verheißungsvollen Rabatten steckt, erfährst du hier bei uns.
Insel der Milliardäre: Netflix feuchter Traum für ÖVP und FPÖ
Die Netflix-Serie "Insel der Milliardäre" kommt als unschuldige Komödie daher, porträtiert im Grunde jedoch ein erzkonservatives Weltbild.